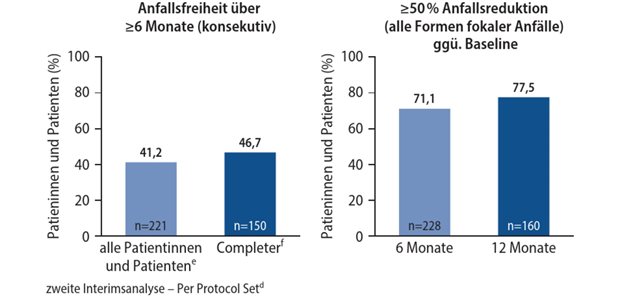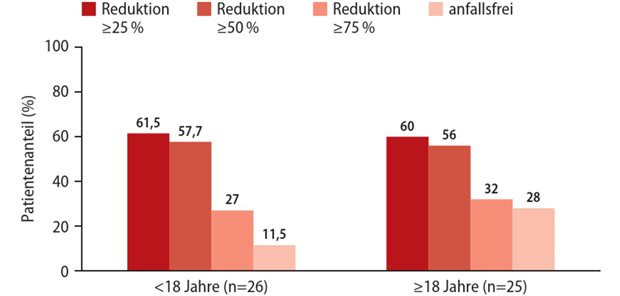PTBS
Traumatischer Stress führt zu DNA-Schäden
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) beeinflusst das Immunsystem und die Zellalterung.
Veröffentlicht:KREFELD. Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist keine isolierte innerpsychische Reaktion auf besonders belastende Erlebnisse, sondern eng mit anderen körperlichen Funktionen verwoben.
Darauf weisen der Berufsverband Deutscher Nervenärzte (BVDN) und der Berufsverband Deutscher Psychiater (BVDP) hin.
"Es braucht bei der Behandlung der PTBS medizinisch-somatische Strategien und psychotherapeutische Ansätze gleichermaßen", wird der Vorsitzende des BVDN, Dr. Frank Bergmann, zitiert.
Er betont, Nervenärzte beziehungsweise Psychiater und Neurologen seien in vielerlei Hinsicht mit der PTBS befasst. Sie sei abzugrenzen von Anpassungsstörungen, von der posttraumatischen Belastungsreaktion, von anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst- oder Panikstörungen und von psychosomatischen Krankheitsbildern. "Besonders wichtig ist außerdem eine sorgfältige Medikamentenanamnese", so Bergmann.
Das Lebenszeitrisiko für eine PTBS liegt bei Frauen bei zehn bis zwölf Prozent, bei Männern bei rund fünf bis sechs Prozent. "Eine PTBS kann jeden treffen, sie hat nichts mit Schwäche zu tun", berichtet Dr. Christa Roth-Sackenheim, Vorsitzende des BVDP, in der Mitteilung.
Sie betonte aber, dass nicht jedes Trauma zwingend eine Belastungsstörung auslöse, vielmehr müssten dafür mehrere verschiedene Faktoren zusammenkommen.
Stress macht krank
Außer der Zahl erlebter traumatischer Ereignisse und ihrer Stärke sind auch genetische Faktoren bei der Entstehung einer PTBS von Bedeutung. Traumatischer Stress erhöht das Risiko für verschiedene Krankheiten.
Darauf weist Professor Iris-Tatjana Kolassa von der Uni Ulm in der Mitteilung hin.
"Das Risiko für ischämische Herzerkrankungen, Krebs, Schlaganfall und Diabetes steigt bekanntermaßen, die Frage ist aber, warum dies so ist."
Traumaforscher konnten in den vergangenen fünf Jahren langfristige Auswirkungen traumatischer Belastungen bis hinab auf die Einzelzellebene nachweisen. Sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach mitverantwortlich für das erhöhte Krankheitsrisiko nach traumatischem Stress. Beispiele dafür sindlaut Kolassa:
› Das Infektionsrisiko steigt durch eine Abnahme der T-Zellen des Immunsystems.
› Auch die so genannten regulatorischen T-Zellen nehmen ab, was das Risiko für Autoimmunerkrankungen erhöht.
› Bei verschiedenen Immunzellen sind verkürzte Telomere nachweisbar, was die Zellen vorzeitig altern lässt.
› Nachweisbar sind außerdem vermehrte DNA-Schädigungen.
"Es existiert ein Dosis-Wirkungs-Effekt: je mehr traumatischer Stress eine Person erlebt hat, desto stärker sind die Effekte in den jeweiligen biologischen Systemen", so Kolassa. (eb)