Ivabradin senkt Ereignisrate bei Herzinsuffizienz
SHIFT-Studie: Vor allem Klinikaufnahmen reduziert
STOCKHOLM (ob). Eine Reduktion der Herzfrequenz mit Ivabradin senkt signifikant das Risiko für klinische Ereignisse bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Vor allem Klinikeinweisungen wegen sich verschlechternder Herzinsuffizienz ließen sich damit in der SHIFT-Studie verhindern.
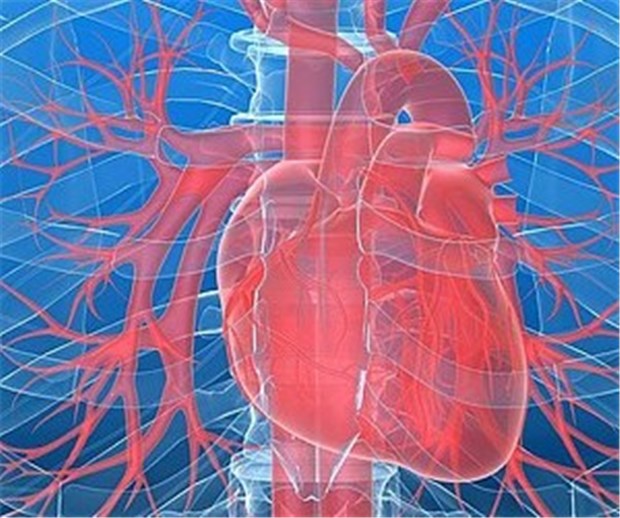
Patienten mit Herzinsuffizienz profitierten in der SHIFT-Studie von einer Reduktion der Herzfrequenz mit Ivadrabin.
© Sebastian Kaulitzki / fotolia.com
An der jetzt beim Kardiologenkongress in Stockholm präsentierten SHIFT-Studie waren 6558 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz auf Basis einer linksventrikulären Dysfunktion beteiligt. Ein wichtiges Einschlusskriterium war die Ruheherzfrequenz, die mindestens 70 Schläge pro Minute betragen musste.
Zusätzlich zur bei Herzinsuffizienz üblichen Standardtherapie einschließlich Betablocker (zu 89 Prozent) erhielten die Studienteilnehmer randomisiert entweder eine Behandlung mit Ivabradin (Procoralan®, Zieldosis 7,5 mg zweimal täglich) oder Placebo.
Im Verlauf von knapp 23 Monaten reduzierte Ivabradin die Rate primärer Endpunktereignisse (kardiovaskulärer Tod und Klinikeinweisung wegen sich verschlechternder Herzinsuffizienz) signifikant von 29 Prozent (Placebo-Gruppe) auf 24 Prozent.
Ausschlaggebend für diese relative Risikoreduktion um 18 Prozent war eine signifikante Verringerung von durch Herzinsuffizienz bedingten Klinikeinweisungen. Die Rate entsprechender Ereignisse wurde durch Ivabradin signifikant um 26 Prozent verringert (16 versus 21 Prozent). Auch die Zahl der Todesfälle infolge Herzinsuffizienz wurde signifikant reduziert.
Auf Basis der absoluten Risikoreduktion errechneten die Studienautoren, dass 26 Patienten mit Herzinsuffizienz und einer Herzfrequenz über 70 Schlägen pro Minute ein Jahr lang mit Ivabradin behandelt werden müssten, um einen kardiovaskulären Todesfall oder eine Klinikeinweisung wegen sich verschlechternder Herzinsuffizienz zu verhindern. Die Herzfrequenz der Studienteilnehmer lag zu Beginn im Schnitt bei 79,9 Schlägen pro Minute. Im Vergleich zu Placebo kam es unter Ivabradin zu einer Abnahme um rund 11 Schläge. Die Höhe der Ausgangsherzfrequenz schien Einfluss auf das Ausmaß des klinischen Nutzens des If-Kanalblockers zu haben. Bei ihrer Analyse von Subgruppen stellten die Untersucher nämlich fest, dass ein signifikanter Therapieeffekt nur bei Patienten auszumachen war, deren Ausgangsfrequenz über dem Median von 77 Schlägen pro Minute lag. Im Fokus einer weiteren Subgruppenanalyse standen diejenigen Patienten, bei denen die Dosis des Betablockers mindestens 50 Prozent der empfohlenen Zieldosis entsprach. In dieser Subgruppe gab es beim primären kombinierten Endpunkt keinen signifikanten Unterschied, allerdings reduzierte Ivabradin auch hier signifikant die Rate der Klinikeinweisungen infolge Herzinsuffizienz. Allerdings war in dieser Subgruppe auch die Ereignisrate vergleichsweise niedrig, was die statistische Teststärke geschmälert haben könnte. Ivabradin erwies sich insgesamt als gut verträglich: Zwar kam es unter dieser Therapie häufiger zu Bradykardien - die Rate schwerwiegender Nebenwirkungen war aber niedriger als in der Placebo-Gruppe. Die SHIFT-Studie ist zeitgleich mit ihrer Präsentation bei ESC-Kongress auch im Fachblatt "The Lancet" publiziert worden.
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Ein Spiegelbild der täglichen Praxis







