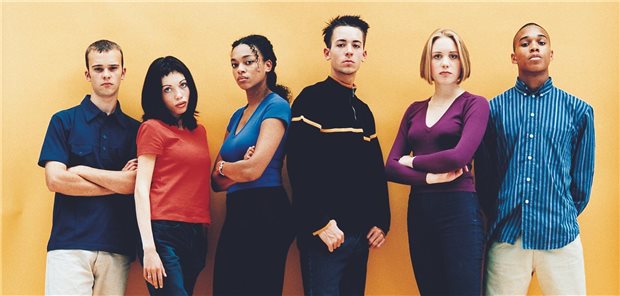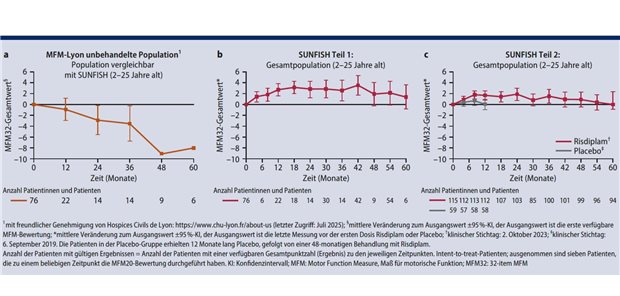Dänische Studie
Körperlich fitte Schüler sind besser in Mathe
Körperlich fitte Kinder glänzen nicht nur durch schnellere Reaktionszeiten, sie schneiden auch in Mathetests besser ab als träge Klassenkameraden.
Veröffentlicht:
Geht schlanken Schülern schneller das Licht auf?
© BeTa-Artworks / fotolia.com
ODENSE. Dämpft zu viel Fett im Bauch und auf den Hüften tatsächlich die geistigen Fähigkeiten? Oder tendieren phlegmatische Menschen eher dazu, viel Gewicht anzusetzen?
Vielleicht ist es auch nur ein Vorurteil, dass dicke Menschen geistig besonders träge sind. Sollte aber tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Übergewicht und schlechter geistiger Leistung bestehen, wäre es umso wichtiger, Kinder vor dem Dickwerden zu bewahren.
Die wissenschaftliche Literatur liefert in dieser Hinsicht eher widersprüchliche Daten: In einigen Studien schnitten dicke Schulkinder in Kognitionstests nicht schlechter ab als ihre normalgewichtigen Kameraden, in anderen zeigten sie vor allem Nachteile bei der Exekutivfunktion, berichten Forscher um Dr. Tao Huang vom Zentrum für Kindergesundheitsforschung in Odense.
Das Team um Huang wollte dem nun etwas genauer nachgehen und wertete Angaben der Studie "Learning, Cognition and Motion (LCoMotion)" aus, an der sich knapp 760 dänische Schüler aus siebten und achten Klassen beteiligt hatten - ihr Alter betrug im Schnitt 13 Jahre (J Pediatr 2015; online 6. August 2015).
In der Studie wurden primär Methoden geprüft, um das Lernvermögen und die kognitive Leistung der Schüler zu verbessern. Die ausführlichen Tests während der Basisuntersuchung machten sich nun Huang und Mitarbeiter für ihre Analyse zunutze.
So untersuchten Ärzte und Psychologen zunächst die vorhandenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Dabei mussten die Kinder bei einem Lauftest 15 Sekunden rennen, 15 Sekunden anhalten und wieder rennen.
Geschaut wurde, wie viele Meter sie auf diese Weise in zehn Minuten schafften. Dies diente den Forschern als Maß für die aerobe Fitness.
Test auf inhibitorische Kontrolle
Die Exekutivfunktion prüften die Wissenschaftler mit einer Variante des Erikson-Flanker-Tests. Dabei mussten die Schüler möglichst schnell auf einem Bildschirm die Richtung eines zentralen Pfeils erkennen, der von anderen Pfeilen umgeben war.
Diese Pfeile konnte in dieselben Richtung laufen (kongruent), also etwa >>>>>, oder in die entgegengesetzte Richtung (inkongruent), etwa >><>> (hier geht es zur Online-Version zum Selbsttest).
Die Schüler markierten nun mit einer Taste die Richtung (links oder rechts). Getestet wurden dabei die Genauigkeit und die Reaktionsgeschwindigkeit.
Der Test erfasst unter anderem die inhibitorische Kontrolle, also die Fähigkeit, falsche Antworten bei inkongruenten Stimuli zu unterdrücken und die Stimuli trotz störendem Umfeld richtig zu erkennen.
Zuletzt prüften die Forscher die kognitiven Fähigkeiten der Schüler auch über einen Mathetest.
Im Schnitt benötigten die Kinder für kongruente Stimuli 462 ms, wobei sie 95 Prozent der Pfeilrichtungen korrekt angaben. Jungs schnitten hierbei etwas, wenn auch nicht signifikant besser ab als Mädchen.
Dagegen hatten die Mädchen bei den inkongruenten Stimuli die Nase vorn: Sie waren zwar auch hier geringfügig langsamer, dafür genauer. Die Mathetests verliefen für die Jungs mit 21,5 versus 20,3 Punkten wiederum etwas besser.
Dicke sind langsamer und machen mehr Fehler
Nun schauten die Forscher, wie gut dicke Kinder abschnitten. Wie sich herausstellte, waren sie signifikant langsamer bei inkongruenten Stimuli, auch machten sie deutlich mehr Fehler.
Dies war sowohl mit Blick auf den BMI der Fall, als auch mit Bezug auf den Bauchumfang. Das Ergebnis war ferner unabhängig von der aeroben Fitness.
Bei den kongruenten Stimuli schnitten die Dicken ebenfalls etwas schlechter ab, hier war der Unterschied aber nicht signifikant.
Die Forscher um Huang schließen daraus: Dicke Kinder haben durchaus ein Problem mit der inhibitorischen Kontrolle - einem der Kernaspekte der Exekutivfunktion.
Die Kindergesundheitsforscher wollten zudem wissen, ob eine hohe Fitness zu einem besonders guten Ergebnis beim Flanker-Test führt. Dies war in der Tat der Fall.
Signifikant waren die Unterschiede allerdings nur bei der Reaktionszeit: Die fittesten Kinder konnten die Stimuli am schnellsten erkennen, und zwar sowohl die kongruenten als auch die inkongruenten, und dies unabhängig von ihrem Gewicht.
Dicke Kinder schlechter in Mathe
Bei den Matheresultaten ergab sich ein ähnliches Bild: Die dicken Kinder schnitten etwas schlechter ab, der Unterschied war aber nicht signifikant. Hochsignifikant (p < 0,001) waren die Unterschiede hingegen bei den körperlich fitten Kindern: Je besser die aerobe Fitness, umso besser das Ergebnis im Mathetest.
Was lässt sich nun daraus schließen? Zunächst passen die Resultate zu den bisherigen Erkenntnissen bei Erwachsenen, wonach viel Bewegung die kognitive Funktion steigert und Übergewicht diese eher schmälert.
Allerdings lässt sich das eine trotz Griff in die statistische Adjustierungs-Trickkiste sicher nicht klar vom anderen trennen - Dicke sind nun einmal selten körperlich aktiv.
Letztlich kann man wieder einmal nur die Empfehlung daraus ableiten, dass Kinder möglichst viel Zeit an der frischen Luft und weniger an Computer- und Fernseherbildschirmen verbringen sollten.
Doch eine große Verbesserung der Schulleistungen dürfen sich Eltern nicht versprechen, wenn es ihnen gelingt, den Nachwuchs abzuspecken und für mehr Sport zu begeistern: Die Auswirkungen auf die Kognition sind nach Ansicht der Studienautoren um Huang eher moderat.