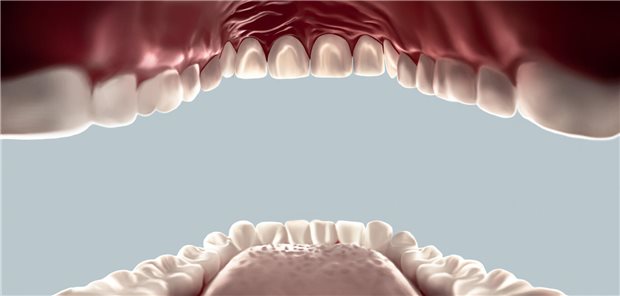DAK-Chef: "Ja, wir sprechen auch mit anderen Kassen"
Professor Herbert Rebscher, DAK-Chef, musste in letzter Zeit viel Kritik einstecken: Wettbewerber munkeln bereits über eine mögliche Insolvenz der DAK. Derweil lotet Rebscher aus, wo seine Kasse in fünf Jahren stehen soll.
Veröffentlicht:
Professor Herbert Rebscher, Vorstandsvorsitzender der DAK.
© Wigger / DAK
Ärzte Zeitung: Herr Professor Rebscher, die DAK hat als eine der ersten Kassen einen Zusatzbeitrag von acht Euro eingeführt. Daraufhin sind viele ihrer Mitglieder abgewandert. Hand aufs Herz: Wie geht es der DAK heute?
Professor Herbert Rebscher: Wir haben im ersten Quartal einen Überschuss von 30 Millionen Euro erwirtschaftet. Allerdings würde ich die erste Quartalsstatistik nicht überschätzen. Die Abwanderung von Mitgliedern wird zum Beispiel erst im zweiten oder dritten Quartal spürbar. Dennoch: Andere Kassen bräuchten eigentlich auch einen Zusatzbeitrag. Und das schon länger.
Ärzte Zeitung: Wie stellt sich denn bis dato die Zahlungsquote beim Zusatzbeitrag dar?
Rebscher: Wir haben 4,8 Millionen Mitglieder, die prämienpflichtig sind. Davon haben 2,9 Millionen Versicherte der DAK direkt in den ersten Wochen eine Einzugsermächtigung erteilt. Viele haben das erste Schreiben aber sicherlich auch gar nicht zur Kenntnis genommen, vielleicht auch nicht verstanden. Insgesamt haben wir extremen Aufwand und Bürokratie für einen so geringen Betrag.
Ärzte Zeitung: Ist ein höherer Beitragssatz erforderlich, so wie es die Forderung der Barmer/GEK ist?
Rebscher: Ich würde jedenfalls gerne morgen unseren Mitgliedern einen netten Brief schreiben: "Das war es mit dem Zusatzbeitrag". Eine Lösung über den Beitragssatz wäre jedenfalls wesentlich solider. Wenn sie die 169 gesetzlichen Krankenkassen fragen, kriegen sie 169 Mal ein überzeugtes: "Ja, wir wollen den Beitragssatz wieder selbst bestimmen". Das wäre zumindest eine vernünftige Form von Wettbewerb.
Ärzte Zeitung: Derzeit konzentriert sich die Koalition sehr auf die Probleme der GKV. Werden dabei die Probleme der PKV übersehen? Rebscher: Bei Licht betrachtet hat die PKV größere Probleme als die GKV. Die PKV hat seit zehn Jahren doppelt so hohe Ausgabensteigerungen. Das Nebeneinander von privater Vollversicherung an einer Einkommensgrenze ist ein ziemlich großer Unfug. Das bestätigten alle Gutachten. Es ist Unsinn zu sagen: Wenn Du ärmer bist als 4000 Euro monatlich, musst Du solidarisch sein. Und wenn Du reicher bist, darfst Du egoistisch sein. Diese Logik erschließt sich niemandem.
Was uns fehlt, ist eine saubere Trennung in Vollversicherung und Zusatzversicherung. Viele kritische Stimmen bezweifeln ja sogar, dass das PKV-Modell zukunftssicher ist. Die PKV wurde zwar durch den Koalitionsvertrag gestärkt, aber man muss dennoch abwarten, wie sich die Märkte entwickeln. Das wäre übrigens der einzige Charme einer Kopfpauschale: Sie könnte zeigen, wie günstig die GKV tatsächlich ist.
Ärzte Zeitung: Was sagen Sie zu Gerüchten, die DAK werde bald fusionieren?
Rebscher: Das haben wir doch gerade getan mit der HMK zum 1. Januar 2010. Wir müssen ständig ausloten, wo wir in vier oder fünf Jahren stehen wollen. Und ja, wir sprechen auch mit anderen Kassen.
Ärzte Zeitung: Und mit welcher Krankenkasse verhandeln Sie?
Rebscher: Dazu möchte ich derzeit nichts sagen.
Ärzte Zeitung: Dem Gesundheitsfonds droht ein Milliardendefizit. Bei welchen Ausgabenposten der GKV muss am dringendsten gespart werden?
Rebscher: Es ist gut, dass Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler die Ausgaben bei den Arzneimitteln anpackt. Die geplante Erhöhung des Herstellerrabatts von sechs auf 16 Prozent ist ausgesprochen sinnvoll. Wenn die Politik aber gleichzeitig zusieht, wie der schon längst akzeptiere Apothekenabschlag von 2,30 auf 1,75 Euro gesenkt wird, dann laufen die durch den Herstellerrabatt ersparten 600 Millionen Euro an der Kasse vorbei und zwar direkt zu den Apothekern. Und die bräuchten es vermutlich noch nicht einmal. Die Kassen hätten so von den Einsparungen im Jahr 2010 nichts.
Das Ziel muss aber sein, 2010 und 2011 ein möglichst ausgeglichenes Budget zu haben. Um das zu erreichen, müssen die Beiträge erhöht und Honorare begrenzt werden, plus das Arzneimittelsparpaket. Wir sollten vor allem wieder erkennen, dass viele im Gesundheitssystem beteiligt sind und nicht eine einzelne Gruppe die Lasten schultern lassen.
Ärzte Zeitung: Was sagen Sie zu der von einzelnen Koalitionspolitikern geforderten Nullrunde für Ärzte und Krankenhäusern?
Rebscher: In dieser Krisensituation wäre doch eigentlich jede Berufsgruppe froh, wenn sie lediglich eine Nullrunde hätte. Es ist die Aufgabe der politischen Führung, den Menschen zu sagen: Diese Krise geht auch nicht an den Menschen vorbei, die ihr Einkommen aus den Krankenkassenbeiträgen generieren. Es war der politische Wille, die Honorare der Ärzte zu erhöhen. Das will ich gar nicht kritisieren. Aber jetzt haben wir eine Finanzkrise, die die Einnahmen in der GKV entsprechend senkt.
Ärzte Zeitung: Die DAK ist als gesetzliche Kasse verpflichtet, Hausarztverträge anzubieten. In welchen Regionen stehen - geschiedste - Hausarztverträge kurz vor dem Start?
Rebscher: Für die DAK fällt der nächste Schiedsspruch wohl in Nordrhein-Westfalen. Die Hausarztverträge wurden uns aber unter einem politisch falschen Etikett verkauft. Sie galten als Wettbewerb fördernde Selektivverträge, mutierten aber zu einem Einheitsvertrag. Der wurde zwar nicht formal geschaffen, aber faktisch zugelassen. Wir erleben hier eine neue Monopolisierung - dabei waren wir eigentlich angetreten, Sektoren zu überwinden.
Zurzeit sehe da aber ein zusätzliches Problem: Die Ärzte im Kollektivvertrag schultern ein kollektives Risiko. Die Ärzte, die einen Selektivvertrag haben, bleiben aber von jedem Risiko unbetroffen. Das ist ja quasi eine Werbeaktion, um möglichst schnell aus dem System auszusteigen. Deshalb müssen meiner Ansicht nach in ein Sparmodell auch die Hausarztverträge einbezogen werden.
Die Kassen sollten hingegen nicht gezwungen werden, mehr Geld in die gleiche hausärztliche Versorgung zu stecken. Die Hausarztverträge sollten zumindest ausgesetzt werden. Das wäre eine notwendige Beteiligung der Hausärzte an den momentanen finanziellen Lasten. Es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass eine Gruppe, die auch noch das Kollektivsystem destabilisiert, nicht an den Belastungen teilhat, die alle schultern.
Ärzte Zeitung: Werden Sie die Hausarztverträge - ob geschiedst oder nicht - bewerben oder überlassen Sie diesen Job dem Hausärzteverband?
Rebscher: Ich muss immer dann einen Hausarztvertrag anbieten, wenn ein Schiedsspruch mich dazu zwingt. Es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, etwas zu bewerben, bei dem man sinnlos Geld ausgibt. Das müssten dann schon die begründen können, die da aktiv sind.
Ärzte Zeitung: Die DAK hat ein Prüfinstrument für Selektivverträge entwickelt, mit dem der Erfolg dieser Verträge gemessen werden soll. Mit welchem Ergebnis?
Rebscher: Selektivverträge sind ja nicht für alle Menschen interessant, sondern nur für kranke Menschen mit einer ganz bestimmten Indikation.Wir schaffen zum Vergleich statistische Zwillinge. In dieser streng anonymen Vergleichsgruppe sind nicht nur alle Patienten drin, die dieselbe Indikation haben - zum Beispiel eine neue Hüfte -, sondern auch Menschen mit dem gleichen Alter, Geschlecht - vielleicht sogar bisherige Leistungsausgaben und Interventionen. Wir vergleichen also nicht schwerere Fälle mit leichteren. Damit können wir dann nach zwei oder drei Jahren sehen, ob ein Vertrag sinnvoll war: Das ist Versorgungsforschung im Kleinen.
Die Konsequenz ist dann, dass man Verträge, die Sinn machen, multipliziert. So zum Beispiel unser Vertrag "Herz im Takt", den wir bundesweit ausrollen. Aber man trennt sich auch von Verträgen. Am Anfang wird eben viel versucht, und nach einer Zeit sortiert man das mal: Was läuft medizinisch gut, was läuft ökonomisch gut, wo sind Patienten zufrieden? Dann entwickelt sich die Verträge auf einem anderen Niveau: Man hat nicht mehr viele einzelne Blümchen, sondern fünf oder sechs schöne Sträuße. Das ist auch für die Ärzte sinnvoll, denn sie wollen auch nicht mit fünf verschiedenen Vertragsmustern hantieren. Es trennt sich die Spreu vom Weizen - und das ist der Sinn von Wettbewerb.
Das Gespräch führte Sunna Gieseke