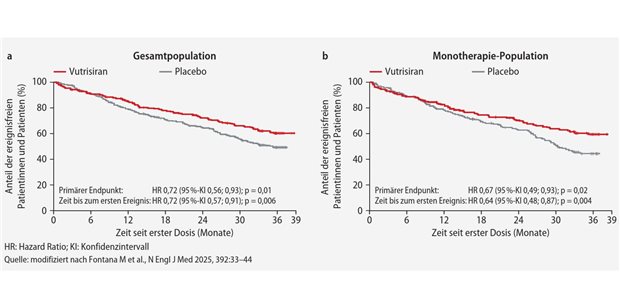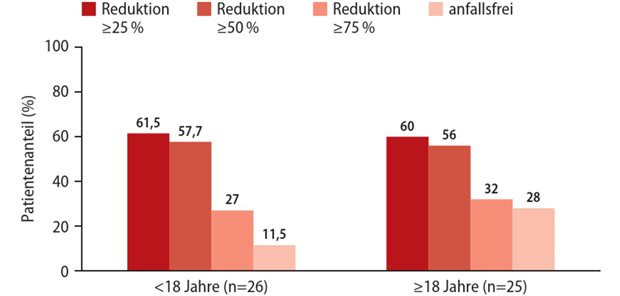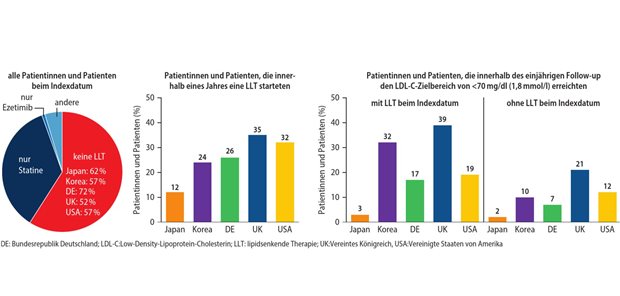Das Geschlecht bestimmt die Arznei
Der kleine Unterschied sorgt für große Unterschiede in den Praxen: Ärzte stellen Frauen andere Rezepte aus als Männern - und geben ihnen viel mehr Medikamente. Das geht aus den Reports der Barmer GEK und der Techniker Krankenkasse hervor.
Veröffentlicht:BERLIN. Die Zahlen zu Arzneimittelverordnungen, die die Barmer GEK am Dienstag vorgelegt hat, sprechen eine deutliche Sprache: Frauen erhalten mehr Medikamente für die Seele, Männer mehr für den Körper. Im Verordnungsverhalten von Ärztinnen und Ärzten wirkten eingefahrene Geschlechterrollen fort.
Das hat Konsequenzen für die gesetzlich versicherten Frauen. "Bei Tranquilizern und Schlafmitteln ist von 1,2 Millionen Abhängigen auszugehen, zwei Drittel davon sind Frauen im höheren Lebensalter", sagte Studienautor Professor Gerd Glaeske bei der Vorstellung des Barmer GEK Arzneimittelreports 2012.
Die auffällig häufige Verordnung von Psychopharmaka hänge wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Frauen sich wegen seelischer Belastungen eher einem Arzt anvertrauten als Männer.
Zwei- bis dreimal so oft wie Männern verschreiben Ärzte ihren Patientinnen Betablocker, Antidepressiva, Tranquilizer, Hypnotika oder Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, zeigt der Report auf.
Als besonders schwerwiegend werten die Autoren die ihrer Ansicht nach unnötig häufige Abhängigkeit von Frauen von Benzodiazepinen.
Glaeske, der das Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen leitet,verurteilte, dass vor allem Frauen Beruhigungsmittel, Antidepressiva und Schlafmittel in Dauertherapie verordnet bekämen, oft über das nötige Maß hinaus und nur, weil sich die Patientinnen an die Mittel gewöhnt hätten, Probleme beim Absetzen bekämen und ohne die Pillen ihren Alltag nicht mehr ertrügen.
Benzodiazepinschwerpunktpraxen
Diese Daten bildeten allerdings nur die halbe Wahrheit ab, betonte Glaeske. Es sei bekannt, dass bereits mehr als die Hälfte aller Benzodiazepine auf Privatrezept verordnet würden, um bei den Kassen nicht auffällig zu werden.
Es hätten sich regelrechte "Benzodiazepinschwerpunktpraxen" herausgebildet. Diese Aussagen decken sich mit Feststellungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
Andererseits sterben Frauen häufiger an Herzinfarkten als Männer, weil Ärzte die weiblichen Symptome zu spät erkennen. Anders als bei Männern äußere sich ein einsetzender Infarkt bei Frauen eher in Erschöpfung, Übelkeit und Erbrechen.
Deshalb hätten Frauen ein erhöhtes Risiko, nicht angemessen behandelt zu werden, weil zu viel Zeit verstrichen sei. Auch diese beunruhigende Nachricht destillieren die Studienautoren aus ihren Ergebnissen.
Ein starkes Indiz dafür ist, dass die größte deutsche Krankenkasse für Männer 30 Millionen Euro für Thrombozytenaggregationshemmer ausgegeben hat, für Frauen nur knapp 23 Millionen Euro, obwohl lediglich 40 Prozent der Barmer GEK-Versicherten Männer sind.
Um für Frauen mehr Arzneimittelsicherheit herzustellen, forderte Gerd Glaeske eine Frauen-Medikamenten-Liste zu erstellen. Vorbild könne die Priscus-Liste für ältere Patienten sein.
Pendeln geht an die Nerven
Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch der ebenfalls am Dienstag vorgestellte Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK).
Auch nach dessen Daten werden bei Frauen häufiger als bei Männern psychische Störungen diagnostiziert. Aus diesem Grund würden ihnen auch häufiger Psychopharmaka verschrieben.
Der scheidende TK-Chef Norder Klusen betonte, dass Ärzte bei Frauen zudem häufiger psychische Störungen wie zum Beispiel Depressionen diagnostizierten.
Ein höheres Risiko für psychische Störungen hätten auch Beschäftigte in Dienstleistungsberufen wie Callcenter-Mitarbeiter oder Pflegepersonal, so Klusen.
"Dass diese Berufe häufiger von Frauen ausgeübt werden, ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass weibliche Erwerbspersonen seelisch belasteter sind", so Klusen.
Auch Berufspendler sind den TK-Daten zufolge häufiger psychisch krank als ihre Kollegen, die in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen. Sie fehlten im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,2 Tage aufgrund psychischer Störungen wie zum Beispiel einer Depression.
Beschäftigte, die nahe am Arbeitsplatz wohnen, fehlten mit 1,9 Tagen etwas weniger. Wer seinen Wohnsitz gewechselt hat, fehlte hingegen vier Tage.
Doppelt belastet
Etwa 45 Prozent der Arbeitnehmer pendeln. "Mobilität lässt sich natürlich nicht verhindern, wir können aber versuchen, sie gesünder zu gestalten", sagte Klusen. Wichtig sei etwa, ob ein Wohnortwechsel freiwillig war.
Dem Report zufolge sind Pendler durchschnittlich etwas seltener krankgeschrieben (Pendler: 12,7 Tage im Jahr, andere Beschäftigte: 12,9 Tage im Jahr). Insgesamt seien jedoch psychisch bedingte Fehlzeiten - wie bereits in den Jahren zuvor - deutlich gestiegen (plus 6,3 Prozent), sagte Klusen.
Besonders betroffen seien Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg. Auch bei den Altersgruppen gebe es deutliche Unterschiede: Bei Beschäftigten zwischen Mitte dreißig und Mitte fünfzig werde häufiger eine psychischen Störung diagnostiziert.
Sie seien oftmals mit Familie und Beruf doppelt belastet, so Klusen. "Die Generation befindet sich beruflich häufig in der Phase, in der entscheidende Weichen für die Karriere gestellt werden", sagte Klusen.
Um die Arbeitnehmer zu entlasten, sei es wichtig, dass die betriebliche Gesundheitsförderung auch verstärkt den Anforderungen einer mobileren und flexibleren Arbeitswelt widme. Dazu gehören nach Ansicht des TK-Chefs unter anderem Home-Office-Angebote, Telefon- und Videokonferenzen.
Lob und Tadel für die Sparpläne der Barmer GEK
Weiter an der Sparschraube drehen zu wollen, hat der Barmer GEK-Vize Dr. Rolf-Ulrich Schlenker am Dienstag in Berlin angekündigt. Von den rund vier Milliarden Euro im Jahr, die die Kasse aktuell für Arzneimittel ausgebe, ließen sich noch bis zu 480 Millionen Euro einsparen, ergänzte der Autor des Barmer GEK-Arzneimittelreports, Professor Gerd Glaeske aus Bremen.
Im Visier haben Schlenker und Glaeske vor allem Me too-Präparate und Zytostatika, die für 21 und zehn Prozent der Ausgaben ständen. Der hohe Anteil an Me too-Mitteln erhärte den Verdacht, dass das Verordnungsverhalten von Ärzten mit Umstellungsprämien beeinflusst werde, sagte Glaeske.
Er appellierte an die zuständigen Gremien, den Bestandsmarkt an Medikamenten schärfer in den Blick zu nehmen. "Kreuzunglücklich" sei er über das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofes, Ärzte seien nicht korrupt, wenn sie Prämien von Pharmaherstellern entgegennehmen würden, sagte Schlenker.
Um eine Katastrofe für die Hygiene im Gesundheitswesen zu verhindern, solle der Gesetzgeber handeln. Er müsse die offenbar vorhandene "gigantische Lücke" in den Gesetzen schließen, um Fangprämien und Schmiergeldzahlungen zu unterbinden.
Schlenker kündigte an, dass die größte deutsche Krankenkasse noch stärker auf Generika setzen wolle. Der Generika-Anteil solle von heute schon überdurchschnittlichen 73 auf 85 Prozent gesteigert werden. Die Kasse bereite Ausschreibungen für den gesamten Markt vor.
Als gutes Signal für den Wettbewerb bezeichnete der Geschäftsführer von Pro Generika, Bork Bretthauer, die Strategie der Kasse, keine Rabattverträge mit Erstanbietern über den Patentablauf hinaus abzuschließen und stattdessen voll auf sinkende Preise durch Anbietervielfalt zu setzen.
"Es ist höchste Zeit, politisch den Weg für Wettbewerb nach Patentablauf für alle Anbieter frei zu machen", sagte Bretthauer.
Schlenker lobte das Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG). Dass die Gremien von bislang 20 Präparaten in der frühen Nutzenbewertung nur zweien einen beträchtlichen Zusatznutzen attestiert hätten, sei ein Beleg dafür, dass bislang zu viele neue Produkte ohne relevanten Zusatznutzen auf den deutschen Markt gedrückt worden seien.
Nach Ansicht des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) verkennen die Kassen verkennten jedoch die durch das AMNOG ausgelösten Probleme. Das Vertrauen darauf, dass GKV, GBA und IQWiG bei der frühen Nutzenbewertung eine hochwertige Versorgung zu fairen Preisen im Auge hätten, sei erschüttert.
Stattdessen seien Versorgungsprobleme bei einzelnen innovativen Arzneimitteln wie etwa dem Antiepileptikum Trobalt® entstanden. Kassen seien nun zu Einzelimporten gezwungen. Das AMNOG habe Fehler. "Wer dies verneint, verschließt die Augen vor der Realität", sagte Dr. Norbert Gerbsch vom BPI.
Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BPI trat Schlenkers Aussagen entgegen, dass die Kasse durch den verstärkten Einsatz von Generika noch sparen könne. Deutschland sei bei Generika Tiefpreisland und die Verordnungsquote bei Generika sei bereits extrem hoch.
Die Rabattverträge führten zu einem Konzentrationsprozess bei den Anbietern, der es standortgebujndenen Unternehmen schwerer mache, auf Dauer am Markt teilzunehmen. (af)