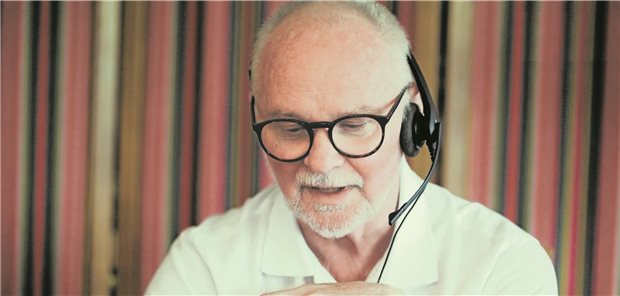Hintergrund
Erfolgreiche Telemedizin: Regionale Verortung und Qualitätssicherung
Telemedizin ist in Deutschland gelebter Alltag. Doch oft herrschen noch Berührungsängste - vor allem auf Arztseite. Zu Unrecht, denn wenn Telemedizin gut aufgezogen wird, profitieren alle.
Veröffentlicht:
In kontrollierten Studien getestet: die Schlaganfall-Telemedizin.
© TEMPiS
Die Telemedizin hat in den letzten Monaten vielfach Schlagzeilen gemacht. Einerseits ist das Thema politisch geworden: Ganze Bundesländer entwickeln Telemedizinstrategien, um vor allem im Krankenhausumfeld Fachexpertise auch künftig flächendeckend zur Verfügung stellen zu können.
Im stationären Bereich gibt es mittlerweile sogar erste Abrechnungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite haben mehrere ambulante Studien die hohen Erwartungen nicht oder nur teilweise erfüllt.
In diesem Spannungsfeld hat die Förderinitiative Versorgungsforschung der Bundesärztekammer am Mittwoch in Berlin ein Telemedizinsymposium abgehalten, das einen weiten Bogen spannte.
Klar wurde, dass die Telemedizin zumindest in den Bereichen Radiologie, Neurologie, Kardiologie und Pathologie nicht mehr experimentell, sondern in Deutschland vieltausendfach gelebte Realität ist.
"Wir müssen deswegen nicht darüber diskutieren, ob Telemedizin gut oder schlecht ist, sondern darüber, wie die konkreten telemedizinischen Konzepte aussehen sollten", betonte Professor Matthias Endres, Direktor der Klinik für Neurologie an der Charité Berlin.
Einig waren sich die Ärztevertreter unter anderem darin, dass Telemedizinprojekte wenn möglich regional verortet sein sollten. "Die Beteiligten an einem Telemedizinszenario sollten sich zumindest einmal die Hand geschüttelt haben", betonte Professor Friedrich Köhler von der Klinik für Kardiologie der Charité Berlin.
Für seine kürzlich beendete Großstudie TIM-HF zur Herzinsuffizienztelemedizin hat sich Köhler mit Dutzenden Niedergelassenen verständigt. Auch die telemedizinischen Schlaganfallnetze in Deutschland basieren überwiegend auf engem persönlichem Kontakt in Form von gemeinsamer Fortbildung und Qualitätssicherung.
So verstandene Telemedizin nutzt nicht nur den Patienten, sondern verbessert auch die Kenntnisse der Ärzte. "Deutschlandweite Konzepte halten wir nicht für sinnvoll", so Endres, der an der Formulierung der Zertifizierungskriterien für Telemedizinkonzepte der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft beteiligt war.
Diese Kriterien waren eine Grundlage für die relativ strenge Formulierung der OPS-Ziffer 8-98b zum Tele-Stroke, die seit Anfang 2011 zur Verfügung steht.
Gerade die Qualitätssicherung sei bei Telemedizinprojekten ein nicht zu unterschätzender Faktor, um die Nachhaltigkeit der Bemühungen zu sichern, betonte Privatdozentin Maria Eberlein-Gonska vom Universitätsklinikum Dresden.
Beispielhaft nannte sie die telemedizinische Anbindung des Kreiskrankenhauses Freiberg in das regionale Tumorboard des Versorgungsnetzes Carus Consilium Sachsen. Das funktioniere deswegen, weil das Krankenhaus nicht nur mit Technik ausgestattet wurde, sondern in klinische Pfade, Krebsregister und Umsetzungskontrolle voll eingebunden sei.
Vor allem den Aufbau eines detaillierten Berichtswesens hält sie für essenziell. Denn sonst ließen sich Erfolg oder Misserfolg eines Projekts weder beurteilen noch belegen.
Dass sich die Telemedizin zunehmend neue Anwendungsbereiche erobert, machte Endres am Beispiel der Neurologie deutlich. Nachdem dort die Schlaganfall-Telemedizin in großen, kontrollierten Studien untersucht und sich unter bestimmten Bedingungen als der herkömmlichen Stroke-Unit-Versorgung ebenbürtig erwiesen hat, konzentrieren sich derzeit viele Forschungsprojekte auf die videogestützte Betreuung von Parkinsonpatienten.
Das größte derartige Projekt umfasste über 3000 Patienten, die jeweils mehrere Wochen lang bis zu viermal am Tag Videosequenzen übermittelten.
"Dieses Konzept eignet sich als Alternative zur stationären Betreuung, etwa wenn eine komplexe Therapieumstellung erforderlich ist", so Endres. Die ersten Daten zeigen, dass sich 90 Prozent der Patienten dadurch besser betreut fühlen.
95 Prozent kommen mit der Technik klar. 80 Prozent sagen, sie könnten ihre Beschwerden auf diese Weise besser mitteilen als in der Klinik. Und bei 70 Prozent verbesserte sich nach einem Monat die klinische Symptomatik.
Dass die Patienten mit der telemedizinischen Versorgung mehrheitlich hoch zufrieden seien, betonten zahlreiche Referenten. Die Bundesärztekammer ließ Patienten zu Wort kommen, die das bestätigten: "Ich habe immer einen Ansprechpartner und fühle mich sicherer", betonte der Herzinfarktpatient Detlef Bülow, der an der TIM-HF-Studie teilgenommen hat.
Auch die Technik sei ausgereift: "Ein Geldautomat ist schwieriger zu bedienen", so Bülow. Wird die Telemedizin vernünftig angepackt, scheint das Arzt-Patienten-Verhältnis also nicht das Problem zu sein.