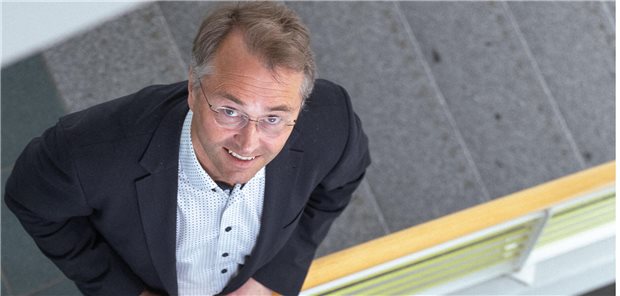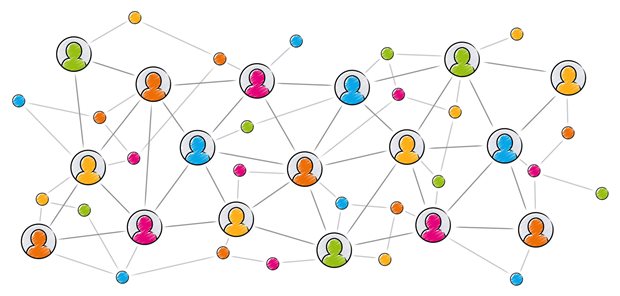"Kliniken mit gutem Ruf haben keine Nachwuchssorgen"
Der 5. Mai 2010 wird ein aufregender Tag für Professor Axel Ekkernkamp. Sein Kongress-Spross, das Deutsche Ärzteforum, feiert runden Geburtstag. Die "Ärzte Zeitung" sprach mit dem Berliner Unfallchirurgen - über Gewinnstreben in der Medizin, Transparenz- Offensiven und eine Krankenhaus-Kita für Arzt-Junior.
Veröffentlicht:
"Das Thema Geld spielt in der Auswahl des Arbeitsplatzes nicht die entscheidende Rolle." (Professor Axel Ekkernkamp, Leiter des Deutschen Ärzteforums 2010) © Bauchspieß
© Bauchspieß
Ärzte Zeitung: Herr Professor Ekkernkamp, dürfen die Verantwortlichen eines Krankenhauses nach Gewinn streben?
Professor Axel Ekkernkamp: Warum sollten sie das nicht tun dürfen?
Ärzte Zeitung: Weil es unethisch ist, sich am Leid eines Patienten eine goldene Nase zu verdienen?
Ekkernkamp: Unethisch wäre es, eine Klinik im real existierenden Wettbewerb um gute Patientenversorgung schlecht aufzustellen, betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu ignorieren und am Ende rote Zahlen zu schreiben. Die Klinik müsste schließen, Patienten müssten in ein entfernt gelegenes Krankenhaus fahren und Mitarbeiter entlassen werden.
Ärzte Zeitung: Ihr Kollege Reiner Gradinger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, beklagt eine "Kommerzialisierung der Medizin". Die Medizin würde sich immer mehr am Profit und immer weniger am Patienten ausrichten. Ist seine Warnung unberechtigt?
Ekkernkamp: Das Handeln von Ärzten soll und muss immer am Patienten ausgerichtet sein. Ihm sind wir verpflichtet. Dies in Erinnerung zu rufen, ist nicht falsch, sondern verdienstvoll. Wir können aber andererseits nicht ständig fordern, beim Thema Gesundheit auch den Aspekt Gesundheitswirtschaft zu berücksichtigen und dann, wenn es um Dinge wie Wettbewerb, Marktwirtschaft oder Gewinn geht, sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben.
Entweder bleibe ich dem Rahmen "Sozialwesen" verhaftet. Dann kann ich aber nicht von Gesundheit als Wachstumsmotor oder Exportschlager sprechen. Oder ich akzeptiere, dass Gesundheit eine Wirtschaftsbranche ist - freilich mit besonderen Kunden und mit Verantwortlichkeit.
Ärzte Zeitung: Diese Kunden vermissen derzeit vor allem Transparenz - etwa bei der Frage, woran erkenne ich eine "gute" Klinik. Hier müsste die Branche dann aber auch mehr tun, damit sie wird wie andere.
Ekkernkamp: Die Krankenhäuser tun ja bereits viel. So haben erst kürzlich 92 Mitgliedskliniken der trägerübergreifenden "Initiative Qualitätsmedizin" (IQM) zum ersten Mal die Sterblichkeitsraten von 31 Erkrankungen mit relativ hoher Mortalität im Internet veröffentlicht. Anhand dieser Routinedaten lässt sich auch für Patienten und Angehörige schnell erkennen, wo das einzelne Krankenhaus im Bundesdurchschnitt steht, und bei welchen Krankheitsbildern es noch Verbesserungspotenzial hat.
Ärzte Zeitung: So werden Defizite benannt. Wie aber lassen sie sich verringern?
Ekkernkamp: Indem Kliniken und die dort tätigen Ärzte noch einen Schritt weitergehen und Erfahrungen sammeln. Bei den IQM-Mitgliedskliniken geschieht das in Form von Peer-Review-Verfahren: Krankenhäuser, die eine hohe Mortalitätsrate aufweisen, sollen von den Erfahrungen der Häuser profitieren, in denen die Sterblichkeitsrate niedrig ist. Im Rahmen der Peer-Review-Verfahren tauschen sich auch die Chefärzte der Kliniken aus. Sie setzen sich an einen Tisch und suchen mit Hilfe von Fallstudien nach Verbesserungsmöglichkeiten in Behandlungsabläufen.
Ärzte Zeitung: Klingt nach Neuland für die Ärzteschaft.
Ekkernkamp: In der Tat. Über eigene Fehler mit Ärzten aus anderen Krankenhäusern zu sprechen, ist für viele Ärzte alles andere als selbstverständlich. Ich denke aber, dieser Lernprozess über die Grenzen des einzelnen Krankenhauses hinweg ist den Schweiß der Edlen wert. Antworten auf die Fragen, was wir leisten und wo wir noch besser werden können und besser werden müssen, dürfen nicht länger in der Schublade "Geheime Kommandosache" abgelegt werden. Diese Zeit ist glücklicherweise vorbei!
Ärzte Zeitung: 92 Krankenhäuser machen bislang mit bei der Transparenzoffensive der IQM. In Deutschland gibt es noch etwa 1900 andere Kliniken. Was ist mit denen?
Ekkernkamp: Es ist ein erster Schritt, den wir voraus gegangenen sind. Das Ganze wird in der Branche, auch transportiert durch zahlreiche Medienberichte, genau beobachtet. Ich bin mir sicher, weitere Kliniken werden nachziehen. Jeder Krankenhausmanager ist im Einvernehmen mit den Chefärzten eingeladen, bei uns mitzumachen. Je mehr Kliniken sich IQM anschließen, desto mehr Transparenz können wir verwirklichen.
Ärzte Zeitung: Im politischen Berlin gibt es derzeit einen regelrechten Wettbewerb um die besten Konzepte gegen einen drohenden Ärztemangel. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in Deutschland noch das Thema "Ärzteschwemme" diskutiert. Was stimmt denn nun?
Ekkernkamp: Ich rate dazu, die Sache differenziert zu betrachten und nicht pauschal von "Ärztemangel" oder "Ärzteschwemme" zu reden. Handlungsbedarf besteht im ambulanten Bereich. Viele Haus- und Fachärzte werden in Kürze in Rente gehen. Daher müssen wir überlegen, wie wir die Versorgungslücke schließen wollen, vor allem dort, wo Hausärzte heute schon fehlen: auf dem Land.
An den Kliniken dagegen arbeiten heute mehr Ärzte als vor Jahren und nicht etwa weniger. Der medizinische Nachwuchs strömt in einer großen Zahl an die Kliniken, und aus Skandinavien oder der Schweiz kommen viele Kollegen zurück nach Deutschland. Kurzum: Der Bedarf an jungen Ärzten ist gedeckt. Das lässt sich auch an der guten Bewerberlage ablesen.
Ärzte Zeitung: Gute Bewerberlage? Der "Marburger Bund" spricht von 5000 Arztstellen, die von den Kliniken nicht besetzt werden können!
Ekkernkamp: Die Botschaft, dass der Bedarf an Klinikärzten weitgehend gedeckt ist, passt einer Gewerkschaft natürlich nicht so recht in den Verhandlungskram. Für die Versorgung der Bevölkerung ist es aber eine richtig gute Geschichte. Ich bleibe dabei: Die Verantwortlichen eines Krankenhauses, das einen guten Ruf genießt, müssen sich ihre Köpfe nicht darüber zerbrechen, ob sich ausreichend viele Ärzte auf freie Stellen bewerben.
Ärzte Zeitung: Was verstehen Sie unter einer gut geführten Klinik?
Ekkernkamp: Ich verstehe darunter ein Krankenhaus, in dem ein Klima herrscht, wo man junge Ärzte ernst nimmt und wo man sie auch an die Hand nimmt und ihnen eine gescheite Weiterbildung bietet. Da kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der ganz wichtig ist: Das Krankenhaus muss genügend Patienten haben. Wenn die Schlagzahl hoch genug und das Weiterbildungsangebot groß genug ist, dann kommt der weiterzubildende Arzt auch gerne. Er weiß, dass er in dieser Klinik in einer überschaubaren Zeit die Inhalte bekommt, die er für eine vernünftige Qualifizierung braucht, die ihm später einmal viele Möglichkeiten der Berufsausübung eröffnet. So etwas spricht sich herum unter Ärzten -und dann kommen die auch. Stichwort "Mund-zu-Mund-Propaganda".
Ärzte Zeitung: Gilt das auch für die Klinik in der viel zitierten "Pampa"?
Ekkernkamp: Ja, gerade für Kliniken in ländlichen Gegenden. Wenn Arbeitsklima und Karrieremöglichkeiten gut sind, dann gehen junge Ärzte auch dort hin. Die Suche nach Spezialisten wird aber auch dort mittelfristig problematisch bleiben.
Ärzte Zeitung: Mehr Geld allein lockt junge Ärzte also nicht an?
Ekkernkamp: Das Thema Geld spielt in der Auswahl des Arbeitsplatzes nicht die entscheidende Rolle. Die Arzttabellen sind heute ja fast alle gleich. Wenn überhaupt, gibt es noch Nuancen bei den Inhalten.
Ärzte Zeitung: Welche?
Ekkernkamp: Das Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) hat, was es bundesweit bislang so nicht gibt, Ärztinnen und Ärzten mit Kindern eine monatliche Zulage von 88,88 Euro je Kind zugebilligt. Wir wollen damit unser Bemühen um familienfreundlichere Strukturen unterstreichen. Und wir wollen Ärzten etwas zugestehen, was Nichtärzte auch kriegen.
Ärzte Zeitung: Sie sprachen von "familienfreundlichen Strukturen" . Haben die Kliniken Nachholbedarf?
Ekkernkamp: Dank der "Marburger Bund"-Kampagne für ein "Familienfreundliches Krankenhaus" hat sich viel getan. Aus gutem Grund: Wenn man möchte, dass auch die Ärzteschaft Kinder bekommt, dann muss man dafür sorgen, dass die Mütter und Väter das auch mit ihrem Beruf im Krankenhaus vereinbaren können. Dazu gehört, dass Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit arbeiten können. Dazu gehört aber auch die Möglichkeit, dass auf die Kinder der Ärzte aufgepasst wird. Aus diesem Grund wollen wir am ukb auch eine eigene Kindertagesstätte aufbauen.
Ärzte Zeitung: Wie soll das konkret aussehen?
Ekkernkamp: Wir wollen die Kita rund um die Uhr offen halten oder mindestens so bedarfsgerecht, dass diejenigen, die in einem 24-Stunden-Klinikbetrieb arbeiten, ihre Kinder in guten Händen wissen, wenn sie im OP stehen. Wir wollen die Betreuung auf jeden Fall mehrsprachig organisieren, weil es einen Mehrwert für die Familien bedeutet, wenn die Kinder schon früh mit einer anderen Sprache aufwachsen. Wir sind optimistisch, dass das Projekt bis Ende des Jahres umgesetzt werden kann.
Das Interview führte Thomas Hommel.
Lesen Sie dazu auch: Ärzteforum: "In den Köpfen hat sich viel bewegt"