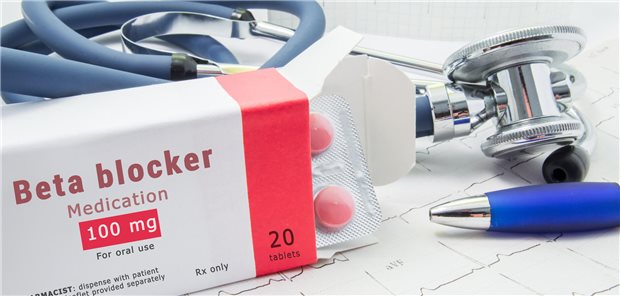Ausländische Ärzte
BÄK-Vize fordert Staatsexamen für alle
Um bundeseinheitliche Strukturen zu schaffen, fordert BÄK-Vizepräsidentin Wenker, dass ausländische Ärzte künftig generell das Staatsexamen ablegen sollten.
Veröffentlicht:HANNOVER. Fast 47.000 ausländische Ärztinnen und Ärzte zählte die Bundesärztekammer (BÄK) Ende 2016 in Deutschland. Aber sind sie alle qualifiziert genug? Die Vizepräsidentin der BÄK und Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN), Dr. Martina Wenker, will es genau wissen. Sie fordert, das deutsche Staatsexamen müsse zukünftig für alle gelten, "seien es deutsche Staatsbürger oder zugewanderte Mitbürger aus Drittstaaten beziehungsweise Nicht-EU-Ländern." Die bisher üblichen Prüfungen seien bundesweit uneinheitlich und nicht ausreichend.
Die Zuwanderung von Ärzten aus allen Teilen der Welt halte weiter an, hieß es. Allein in Niedersachsen wurden 2016 genau 529 Approbationen und 775 Berufserlaubnisse an Ärzte erteilt, die ihr Medizinstudium nicht in Deutschland absolviert haben, so die ÄKN. Die Zahlen für das gesamte Jahr 2017 lägen noch nicht vor, hieß es. "Bis zum 31.10.2017 waren es 334 Approbationen und 732 Berufserlaubnisse."
"Bislang ist die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsnachweisen in den Bundesländern nicht vergleichbar geregelt, für die Approbationsbehörden ist jeder Vorgang wie ein Einzelfall zu behandeln", moniert Wenker. Bei jedem Bewerber müsse geprüft werden, ob die im Heimatland absolvierte Ausbildung mit der durch das deutsche Staatsexamen gewährleisteten Qualität vergleichbar ist. "Diese Prüfung ist hinsichtlich der Sicherheit der Entscheidung und somit des Schutzes der Patienten nicht ausreichend", sagt die ÄKN-Präsidentin.
Ihre Lösung: Wer immer in Deutschland als Arzt arbeiten will, müsse zuerst das deutsche Staatsexamen bestehen – unabhängig von seiner vorausgegangenen Ausbildung. "Nur so könne die Qualität der Versorgung sichergestellt werden, betont Wenker. Zugleich forderte sie eine zentrale Anlaufstelle für ausländische Ärzte. So handhabten es zum Beispiel auch die USA. Wer in den Staaten als Facharzt tätig sein wolle, müsse in einem dreistufigen Verfahren das United States Medical Licensing Exam (USMLE) absolvieren.
Die Ärztekammerpräsidentin präzisiert mit ihrer Forderung den Beschluss des 120. Deutschen Ärztetags 2017. Darin heißt es, dass "die Gleichwertigkeit der medizinischen Grundausbildung aus Drittstaaten in einem bundeseinheitlichen Verfahren und mittels einer gegenüber der zuständigen Approbationsbehörde abzulegenden Prüfung nachzuweisen ist."
Wenker: "Meiner Meinung nach kann so ein bundeseinheitliches Verfahren nur das deutsche Staatsexamen sein." (cben)