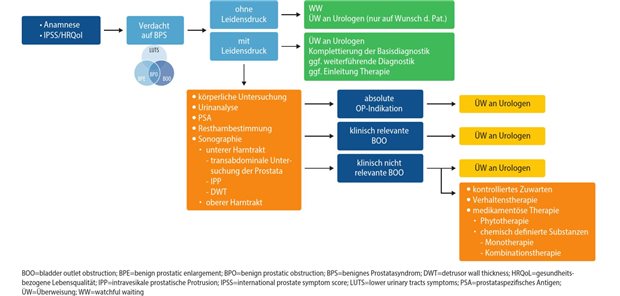Debattengipfel Naturmedizin
Die Fronten bröckeln
Soll sich der Einsatz von Naturheilmitteln an Studien orientieren, oder doch besser am Alltag der Patienten? Beim Debattengipfel in Hamburg zeigte sich, dass es keine einfache Antwort gibt.
Veröffentlicht:
Naturheilmittel sollen rational eingesetzt werden, wo sie Nutzen stiften: Professor Gerd Glaeske, Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen.
© Stephan Gabriel
Grün, gelb oder rot? Die Zuschauer im Hamburger Museum für Völkerkunde müssen Farbe bekennen.
Die gelbe Pappe zeigt an, dass ein Zuschauer Anhänger der These eins ist: "Naturheilmittel müssen erforscht und ihr Einsatz an erster Stelle an den wissenschaftlichen Ergebnissen ausgerichtet werden." Diese Auffassung vertritt Professor Gerd Glaeske.
Der Leiter der Abteilung Arzneimittelforschung im Zentrum für Sozialpolitik an der Uni Bremen durfte sich zwei Mitstreiter suchen.
Seine Wahl fiel auf Professor Theo Dingermann, Direktor des Instituts für Pharmazeutische Biologie der Uni Frankfurt, und Fachapothekerin Dr. Judith Günther, die das Freiburger Büro von pharmafacts führt.
Das Institut bewertet vor allemfür die Stiftung Warentest Arzneimittel. Ihre These hat es schwer im Auditorium: Neun Prozent sind ihrer Meinung vor Beginn der Debatte.
Viele sind noch unentschlossen
Auf große Sympathien stößt dagegen These zwei: "Naturheilmittel müssen erforscht, ihr Einsatz aber an erster Stelle in der Patientenwirklichkeit ausgerichtet werden."
Debattenführer ist Professor Michael Habs, Geschäftsführer des Karlsruher Phytopharmaka-Herstellers Dr. Willmar Schwabe. Auch er hat sich namhafte Unterstützung gesichert: Professor Manfred Schedlowski, Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie am Universitätsklinikum Essen, und Dr. Berthold Musselmann, Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren an der Uni Heidelberg und Ärztlicher Leiter des Naturheilkundeportals www.phytodoc.de.
Das Trio hat ein Heimspiel: 60 Prozent entscheiden sich zu Beginn für ihre These und heben die grüne Pappe. Was aber ist mit der hohen Zahl der Unentschlossenen?
Immerhin 30 Prozent haben sich noch keine Meinung gebildet und sind wie bei politischen Wahlen bis zum Start unentschlossen - sie heben die rote Pappe.
Um sie geht es - und Glaeske macht von Beginn an klar, dass er sie überzeugen will. Sieben Minuten voller Fakten und Überzeugung, dass bei jedem Medikament der Nachweis von Qualität, Sicherheit und Nutzen für die Patienten an erster Stelle stehen muss.
Die Phytotherapie ist für ihn keine besondere Therapierichtung, die Ausnahmen beanspruchen darf.
"Ich möchte, dass diese Therapie rational angewendet und eingesetzt wird, wo sie Nutzen stiftet", sagt Glaeske und fordert konsequenten Nachweis therapeutischen Nutzens, denn: "Natur ist nicht von Natur aus gut."
All das ist Opponent Habs längst bekannt. Gelassen geht er seine sieben Minuten an. Evidenzbasierte Medizin als Dogma lehnt er ab. Studien? Schön und gut, aber: "Studienpatienten und Alltagspatienten sind oft Zweierlei!"
Er ist überzeugt, dass die regulatorische evidenzbasierte Medizin mit ihren trivialisierenden Mittelwertbetrachtungen durch den Trend zur individualisierten Medizin zerbrechen wird.
Auch eine gezielte Zwischenfrage von Glaeske mitten in seine Redezeit bringt Habs nicht aus der Ruhe. Die beiden Debattenführer haben ihre Positionen eindrucksvoll untermauert. Dies gelingt anschließend auch den Mitstreitern.
Dingermann: "Ich habe nichts gegen Phytopharmaka, die nicht genuin klinisch getestet sind. Ich möchte sie nur als solche erkennen können."
Hingegen meint Schedlowski: "Es fehlt an wissenschaftlichen Werkzeugen für die Wirksamkeitsuntersuchung".
Beide Parteien gewinnen hinzu
Die Schlussredner können die Entscheidung bringen. Günther verweist auf das immer unüberschaubarer werdende Angebot an Phytopharmaka und die steigende Zahl an Kombinationsmitteln.
Deren Nutzennachweis sei noch schwieriger als bei Monotherapeutika, unnötige Bestandteile könnten sogar Schaden zufügen.
Besonders problematisch: Die Patienten gehen vom Gegenteil aus. Ihr Fazit: Auch wenn es aufwendig ist, Verbraucher müssen geschützt werden durch Wirksamkeitsnachweise.
Das Schlusswort hat Musselmann. Mit Verve erklärt er den Zuhörern, dass Medizin eben keine reine Wissenschaft ist und es immer eine Uneindeutigkeit geben wird, die nicht messbar ist - was viele Ärzte aber längst aus den Augen verloren haben.
"Aus Halbgöttern in Weiß wurden Jünger der Statistik". Die Abkehr der Medizin von den Geisteswissenschaften, legt Musselmann dar, sei eine Sackgasse.
Denn das, was die aktuelle Mainstream-Medizin unter Forschung und wissenschaftlichen Ergebnissen versteht, ist für ihn nur ein winziger Ausschnitt dessen, was zwischen Arzt und Patient zum Heilungsprozess beitragen sollte.
42 Minuten ließen die Zuhörer die teils hochkarätigen Kurzreden auf sich wirken. Fast alle sind jetzt überzeugt und haben sich eine Meinung gebildet. Glaeske und Co. haben es geschafft: Von neun klettern sie auf 23 Prozent.
Aber auch Habs und sein Team konnten sich auf hohem Niveauweiter steigern: von 60 auf 68 Prozent. Nur rund neun Prozent im Saal bleiben unentschlossen - ein Erfolg der sechs Redner, aber auch des Formats.
Diskussionsstil: In Hamburg wurde auf die englische Art gestritten
Wer ist lauter, wer redet länger auf seinen Gesprächspartner ein, wer fällt wem ins Wort: Es sind nicht zuletzt solche Mittel, die bei einer Diskussion darüber entscheiden, wer die Zuhörer stärker überzeugt. Mit den Argumenten hat dies nicht immer etwas zu tun.
Andere Veranstaltungen geben Vortragenden breiten Raum und führen nach stundenlangen Referaten zu akuter Müdigkeit. Der abschließende Applaus aus dem Publikum ist dann oft nur der Erleichterung über das Ende geschuldet.
Der Initiator des Debattengipfels Naturmedizin 2012, das Unternehmen Dr. Willmar Schwabe, hat deshalb auf die englische Debatte gesetzt: ein klassisches Streitgespräch mit klaren Regeln.
Ausgetragen wurde es im holzgetäfelten Hörsaal im Hamburger Museum für Völkerkunde. Es ging um die Frage, woran die Anwendung der Naturmedizin vorrangig ausgerichtet werden soll, an der wissenschaftlichen Evidenz oder an der Patientenwirklichkeit.
Nach einem Eingangsvortrag durften jeweils drei Vertreter einer These in festgesetzter Länge abwechselnd für ihre Position werben. Sieben Minuten standen jedem der sechs Redner zu.
Was auf den ersten Blick nach knapp bemessener Zeit klingt, kam der Veranstaltung zugute. Die Redner kamen schnell auf den Punkt, vermieden Redundanzen, versuchten mit kurzen Sätzen zu überzeugen.
Natürlich kommt es auch bei diesem Format nicht nur auf den Inhalt an: Eloquenz und Rhetorik sind genauso wichtig wie die Taktik:
Welcher Redner ist an Position eins, zwei oder drei am wirkungsvollsten?
Sollen die besten Argumente zum Start oder zum Schluss fallen?
An welcher Stelle entfaltet die erlaubte Zwischenfrage die höchste Wirkung?
Die sechs Protagonisten um die Debattenführer Professor Gerd Glaeske auf der einen Seite und Professor Michael Habs auf der anderen hatten sich hervorragend auf dieses Format eingestellt und schafften es, ihre Argumente in der vorgegebenen Zeit zu begründen.
Das Auditorium - Ärzte und Apotheker - zeigte ihnen, dass die Argumente verfingen: Beide Seiten schafften es, aus der breiten Riege der Unentschiedenen im Publikum nennenswerte Anteile auf ihre Seite zu ziehen.
Denn ganz im englischen Debattenstil stimmte das Publikum über die Thesen ab. Ein Votum vor der Debatte vermittelte ein erstes Stimmungsbild, die entscheidende Abstimmung folgte nach der Debatte.
Anschließend wurde nachgehakt: In Talkrunden, Interviews und Kurzvorträgen runden ergänzende Informationen und Meinungen das Bild ab.
Fazit: ein Format, das viel zu selten in gesundheitspolitischen Diskussionsrunden in Deutschland berücksichtigt wird.