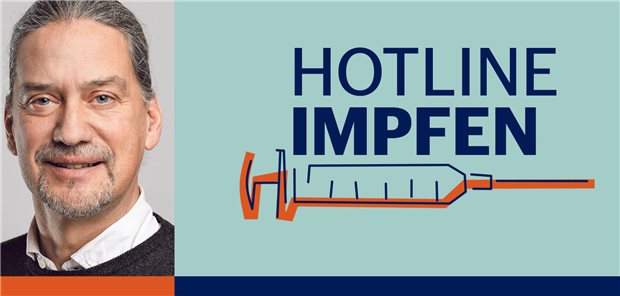Brustkrebsforschung
Krebswirkstoff aus dem Meer
Brustkrebspatientinnen, die am sogenannten Triple-Negativen Subtyp erkranken, haben nur eine geringe Aussicht auf Heilung. Eine neue Behandlungsform für diese und andere Krebsformen könnte ein Naturstoff aus einer Weichkoralle sein.
Veröffentlicht:
Das Meer als Apotheke: Forscher suchen etwa in Weichkorallen nach neuen Arzneistoffen gegen Krebs.
© etfoto / stock.adobe.com
KÖLN. Um die Kommunikation von Immun- und Krebszellen zu blockieren und den Tumor daran zu hindern, Metastasen zu bilden, hat Julia Sperlich von der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften der TH Köln im Rahmen ihrer Doktorarbeit Versuche mit dem Naturstoff Pseudopterosin an Brustkrebszellen durchgeführt. Die Substanz wird von der in der Karibik vorkommenden Weichkoralle Antillogorgia elisabethae gebildet und dient ihr als Schutz gegen Fressfeinde. Wegen seiner entzündungshemmenden Wirkung wird er bereits in Hautcremes verwendet.
Hintergrund ist, dass vor allem an Krebszellen angrenzende Immunzellen das Wachstum eines Tumors stark zu beeinflussen scheinen. "Die Immunzellen haben zwei Seiten: Im Idealfall unterdrücken sie das Tumorwachstum. Unter bestimmten Umständen können sie den Krebs aber auch zu mehr Wachstum anregen", erläutert Sperlich in einer Mitteilung der TH. Die Kommunikation erfolgt dabei über Entzündungsmediatoren – Zytokine.
"Die Untersuchungen von Julia Sperlich haben erstmals den zugrundeliegenden molekularen Mechanismus der antientzündlichen Wirkung von Pseudopterosin aufgedeckt. Sie konnte außerdem zeigen, dass die Entzündungsbotenstoffe, durch die die Tumorzellen mit den benachbarten Immunzellen kommunizieren, in Gegenwart des Naturstoffs blockiert werden", berichtet Prof. Nicole Teusch, Leiterin des Forschungsprojekts "Neue Wirkstoffe aus dem Meer" am Campus Leverkusen der TH Köln.
Der Naturstoff ist allerdings noch weit davon entfernt, ein marktreifes Präparat zu sein. Zudem müssen bislang die Korallen aus 25 bis 30 Meter Meerestiefe geerntet werden, um den Naturstoff zu gewinnen. "Um diesen massiven Eingriff in das Ökosystem zu vermeiden, soll der Stoff im Labor chemisch vereinfacht nachgebaut und gleichzeitig seine Wirksamkeit erhöht werden.", so Sperlich.
Neben der chemischen Entwicklung vereinfachter Wirkstoffe sind Kooperationen mit Kliniken geplant, um pharmakologische Charakterisierungen mit Patientenmaterial auf den Weg zu bringen, wie die TH berichtet. (run)