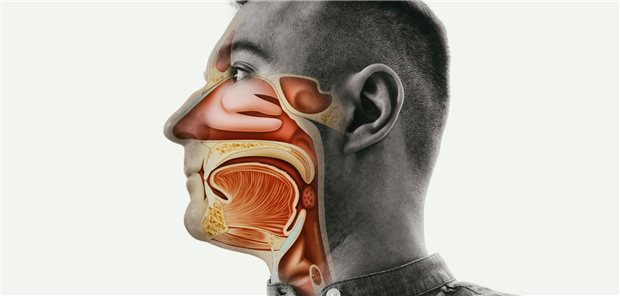Mikrosensoren spüren Prothesenlockerung auf
BERLIN (gvg). Winzige Beschleunigungsmesser sollen Chirurgen künftig vor der eventuellen Revision einer Hüftgelenksendoprothese genauere Informationen darüber liefern, ob das Implantat locker sitzt oder nicht. Auch zum Vergleich verschiedener Prothesensysteme könnte die Technik einmal eingesetzt werden.
Veröffentlicht:Etwa 150 000 künstliche Hüftgelenke werden im Moment in Deutschland Jahr für Jahr implantiert. Dazu kommen etwa 20 000 Revisionsoperationen bei Patienten, bei denen der Verdacht besteht, daß die Prothese sich gelockert haben könnte.
"Von diesen Revisionen sind etwa zweitausend unnötig", schätzte Dr. Robert Eberl von den Kliniken Bergmannsheil in Bochum auf dem 121. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCh) in Berlin. Der Grund: Durch klinische Untersuchung, Röntgenbild und Szintigrafie lasse sich zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber eben nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob sich eine Prothese wirklich gelockert hat.
| Die Ergebnisse bei Tieren sind sehr ermutigend. | |
Abhilfe sollen Mikrosensoren schaffen, die in Zukunft sogar standardmäßig in Implantate eingebaut werden könnten. Diese Sensoren messen mehrmals pro Sekunde die Beschleunigung und liefern die Meßwerte, im Idealfall per Funk, an einen Rechner, der sie auswertet. Es entstehen daraus Kurven, die bei einer Lockerung der Prothese eine charakteristische, zackig-zitternde Form haben.
"Aktuell testen wir solche Sensoren in Tierversuchen, mit sehr ermutigenden Ergebnissen", so Eberl zur "Ärzte Zeitung". Für die Datenübertragung werden im Moment noch Kabel verwendet, doch steht die Funktechnik im Prinzip zur Verfügung, so daß in ein, zwei Jahren auch ein Einsatz bei Patienten möglich erscheint.
DGCh-Präsident Professor Bernward Ulrich findet die Sensortechnik noch aus einem anderen Grund reizvoll: "Wir könnten sie nicht nur zur Diagnostik einsetzen, sondern auch als Instrument zur Qualitätskontrolle, denn die Meßwerte ermöglichen viel objektivere Vergleiche zwischen den verschiedenen Prothesentypen als sie uns im Augenblick möglich sind".