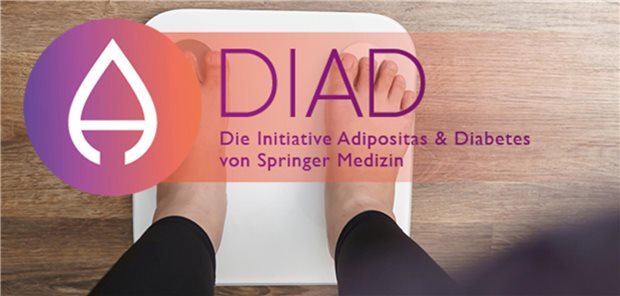Pramlintide unterstützt Insulin bei Typ-1-Diabetes
HANNOVER (hbr). Typ-1-Diabetikern fehlt außer Insulin auch das Hormon Amylin. Das Amylin-Analogon Pramlintide verringert bei ihnen den Blutzuckeranstieg nach dem Essen. Auch der oxidative Streß nimmt signifikant ab.
Veröffentlicht:Das hat Dr. Jörg Limmer aus Kalifornien beim Diabeteskongreß in Hannover berichtet. 19 Patienten mit Typ-1-Diabetes hatten an einer Studie teilgenommen. Sie hatten im Mittel seit 22 Jahren Diabetes, einen HbA1c von 9,4 Prozent und einen Body Mass Index von 27 kg/m². Eine halbe Stunde vor zwei standardisierten Mahlzeiten erhielten sie eine individuell angepaßte Dosis Normal-insulin. Zusätzlich wurde direkt vor dem Essen 60 µg Pramlintide subkutan injiziert oder ein Scheinpräparat.
Pramlintide ist ein synthetisches Analogon des Betazell-Hormons Amylin, das in fortgeschrittener klinischer Entwicklung ist. Amylin wird bei Gesunden zusammen mit Insulin beim Essen ausgeschüttet. Bei Typ-1- Diabetikern sei es praktisch kaum vorhanden, sagte Limmer. Pramlintide supprimiert die postprandiale Glukagonsekretion und verlangsamt die Magenentleerung.
Die Studie ermittelte den Effekt auf den Blutzucker nach dem Essen. Die Wirkung auf den bei Diabetikern in der postprandialen Phase erhöhten oxidativen Streß (OS) wurde anhand der Änderung der Plasmakonzentrationen von OS-Markern wie oxidiertem LDL und Nitrotyrosin ermittelt sowie mit der TRAP-Methode (Total Radical Trapping Antioxidant Parameter) die antioxidative Kapazität. Oxidativer Streß gilt als mitursächlich bei vaskulären Komplikationen.
Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen waren signifikant: Mit Insulin plus Placebo stieg der Blutzucker nach der Mahlzeit - Pramlintide zusätzlich zu Insulin glättete den postprandialen Glukoseanstieg. Ähnlich die Plasmakonzentrationen von Nitrotyrosin und oxidiertem LDL als OS-Marker: mit Placebo ein postprandialer Anstieg - mit Pramlintide ein flacher Verlauf. Die antioxidative Kapazität wird bei hohen Blutzuckerwerten verbraucht. Sie nahm unter Placebo ab. Mit Pramlintide blieb das Niveau stabil. Der Wirkstoff werde gut vertragen, sagte Limmer. Unerwünschte Ereignisse waren leichte bis mittelgradige Hypoglykämien und leichte Übelkeit.