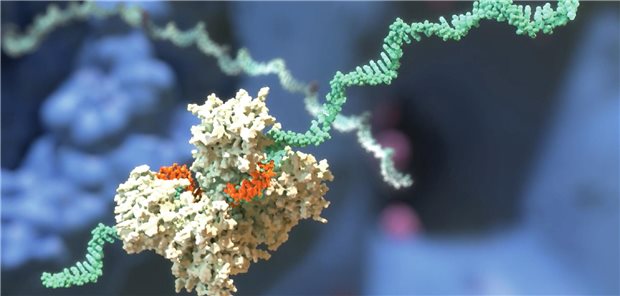Wissenschaft
Mit 80 Jahren immer noch jeden Tag im Labor
Thomas Jovin ist der älteste aktive Forscher am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen – und weiterhin hoch produktiv.
Veröffentlicht:
Unermüdlich: Das Forscherpaar Thomas Jovin und Donna Arndt-Jovin am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen.
© Heidi Niemann
Göttingen. 50 Jahre beim gleichen Arbeitgeber und am gleichen Ort beschäftigt zu sein, das gibt es auch im Wissenschaftsbetrieb eher selten. Nicht nur deshalb dürfte der Berufsweg des Göttinger Max-Planck-Forschers Thomas Jovin rekordverdächtig sein.
1969 wurde er mit 30 Jahren zum bislang jüngsten wissenschaftlichen Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft berufen. In der Folgezeit leistete er wichtige Forschungsbeiträge, veröffentlichte knapp 500 wissenschaftliche Publikationen und entwickelte zahlreiche Techniken und Methoden, die neue Erkenntnisse über molekulare Strukturen und Prozesse in lebenden Zellen ermöglichen.
Im vergangenen Sommer ist er 80 Jahre alt geworden. Seinem Forscherdrang hat das Alter bislang nichts anhaben können: Thomas Jovin ist weiterhin regelmäßig am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie tätig – und damit der älteste aktive Forscher in der Göttinger „Nobelpreis-Schmiede“.
Dabei wollte der gebürtige Argentinier Ende der 1960er Jahre eigentlich nur ein Jahr lang in Göttingen bleiben, um am damaligen Max-Planck-Institut für physikalische Chemie in der Abteilung von Manfred Eigen zu arbeiten.
Danach wollte der Molekularbiologe und Mediziner in die USA zurückkehren, wo er bereits eine Stellenzusage am Massachusetts Institute of Technology (MIT) hatte, das als eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen gilt.
Entscheidung nie bereut
Doch der frisch gekürte Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen wollte den ebenso talentierten wie vielseitigen Wissenschaftler gern in Göttingen halten. In Kürze würde auf Initiative des Nobelpreisträgers ein neues Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie auf dem Göttinger Faßberg entstehen.
Thomas Jovin solle dort als einer der Gründungsdirektoren eine neue Abteilung für Molekularbiologie etablieren, schlug Eigen vor.
Nach einigem Zögern nahm Jovin das Angebot an – und hat es ebenso wie seine Ehefrau Donna Arndt-Jovin, die ebenfalls eine renommierte Wissenschaftlerin ist und bis heute am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie arbeitet, nie bereut: „Wir kennen viele Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt, aber dieses Institut ist einmalig“, sagt Thomas Jovin. „Man hat hier alles, was man braucht, um erstklassige Forschung zu betreiben.“
Gemeinsam leben und forschen
Die beiden Forscher sind seit vielen Jahrzehnten sowohl privat als auch beruflich gemeinsam unterwegs. In den 1960er Jahren hatten beide zunächst in Stanford (Kalifornien) gearbeitet. Thomas Jovin forschte im Labor von Nobelpreisträger Arthur Kornberg, Donna Arndt-Jovin arbeitete beim späteren Chemie-Nobelpreisträger Paul Berg. 1971 heiratete das Forscherpaar, im gleichen Jahr wurde das neu konzipierte Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie gegründet.
Mehr als ein Vierteljahrhundert lang leitete Jovin dort seine Abteilung. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2007 forscht er mit seiner Emeritusgruppe „Labor für Zelluläre Dynamik“ und arbeitet weiter eng mit seiner Frau zusammen.
Dass das Wissenschaftler-Paar nicht nur eine Lebens-, sondern auch eine Forschungsgemeinschaft bildet, lässt sich auch an vielen gemeinsamen wissenschaftlichen Publikationen ablesen. „Wir haben komplementäre Fähigkeiten“, sagt Donna Arndt-Jovin. In letzter Zeit forschen sie beispielsweise an den molekularen Mechanismen, die der Parkinson-Krankheit zugrunde liegen.
Dafür entwickeln sie hochauflösende Mikroskopie-Methoden für lebende Zellen. „Wir haben noch einige Projekte in Arbeit, die wir gerne zu Ende bringen wollen“, sagen die beiden Forscher.
Bei der Betrachtung seiner Wissenschaftlerkarriere fällt auf, dass Thomas Jovin, außer mit Manfred Eigen, auch mit einer Reihe weiterer Nobelpreisträger verbunden war. So stellte er beispielsweise dem britische Biochemiker Fred Sanger hochreine DNA-Polymerase zur Verfügung, womit dieser seine DNA-Sequenzierungsmethode entwickelte. 1980 heimste Sanger dafür zum zweiten Mal den Chemie-Nobelpreis ein.
Jovin hat auch einem anderen Nobelpreisträger den Weg geebnet: Ende der 1990er Jahre setzte er sich dafür ein, den Physiker Stefan Hell nach Göttingen zu holen. Hell wollte mit einer neuen Methode die Beugungsgrenze des Lichts in der Mikroskopie überwinden, fand aber in Deutschland keine Unterstützer.
Jovin, der selbst wichtige Beiträge zur mikroskopischen Bildgebung geleistet hat, hielt die Idee für umsetzbar. Hell bekam am Institut seine Chance, wurde Leiter einer selbstständigen Nachwuchsgruppe und 2002 schließlich Direktor. 2014 erhielt er für die Entwicklung der STED-Mikroskopie den Chemie-Nobelpreis.
Thomas Jovin hatte den richtigen Riecher gehabt.