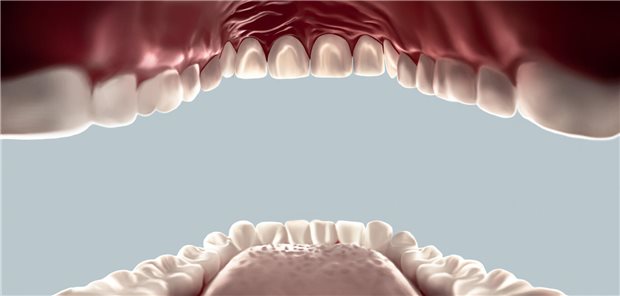Baden-Württemberg
48 Pflegestützpunkte sind Altpeter nicht genug
STUTTGART. In Baden-Württemberg sollen Kassen und Kommunen "deutlich" mehr Pflegestützpunkte etablieren, hat Landessozialministerin Katrin Altpeter (SPD) gefordert.
Sie mahnte über die bisher 48 Einrichtungen hinaus einen "flächendeckenden Ausbau" der Pflegestützpunkte an. Dabei stützt sich das Ministerium nach eigenen Angaben auf Empfehlungen einer Evaluation durch das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). In zwei Landkreisen, Neckar-Odenwald und Biberach, gibt es bisher gar keine Stützpunkte.
Die Einrichtungen im Südwesten arbeiten nicht nach einem einheitlichen Konzept: Manche haben eine zentrale Anlaufstelle, andere kooperieren mit Kommunen. Mancherorts werden auch Sprechstunden in Gemeinden angeboten.
Lokal hat es immer wieder Kritik gegeben. So bezeichnete etwa der Landesvorsitzende des Sozialverbands VdK, Roland Sing, die Zahl der Stützpunkte als zu gering und kommentierte: "Aufgabenbeschreibung, die personelle Besetzung und die Öffnungszeiten lassen nur den Schluss zu, dass hier erhebliches Verbesserungspotenzial (...) gegeben ist."
Ministerin Altpeter bezeichnete die Pflegestützpunkte dennoch als "Erfolgsmodell". Allein in der zweiten Jahreshälfte 2012 habe es 40.000 Kontaktanfragen in den Stützpunkten gegeben. "Es wäre bedauerlich, wenn man auf dieser Basis nicht weiter aufbauen würde."
Ein Thema wird sein, wie die Pflegeberatung der Kassen mit der Arbeit der Stützpunkte besser verzahnt werden kann.
Stützpunkte sollen weiterentwickelt werden
VdK-Landeschef Sing regte eine breitere Aufgabenstellung für die Beratungseinrichtungen an: "Weshalb können Pflegestützpunkte nicht gleichzeitig Wohnraumberatung und Hilfestellungen im praktischen Leben für ältere Menschen geben?"
Sozialministerin Altpeter versprach, bei den Trägern - Pflege- und Krankenkassen sowie kommunalen Landesverbänden - auf eine Weiterentwicklung der Stützpunkte zu drängen.
Unterdessen hat das Statistische Landesamt neue Modellrechnungen über die Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg vorgelegt. Diese könnte von derzeit rund 278.000 auf 381.000 Personen im Jahr 2030 steigen (plus 37 Prozent). Danach würde die Zahl der vollstationär Gepflegten um 46 Prozent auf knapp 129.000 Personen zulegen.
In der ambulanten Pflege würde die Zahl der Pflegebedürftigen um 43 Prozent auf knapp 83.000 wachsen. Pflegegeld würden im Jahr 2030 rund 170.000 Personen erhalten, was einem Anstieg von knapp 28 Prozent entspricht.
Zugrunde gelegt haben die Statistiker dabei eine Status-quo-Rechnung: Sie haben also angenommen, dass sich das Pflegerisiko trotz der zu erwartenden längeren Lebenserwartung nicht verändert. Einschränkend heißt es dann auch, die aufgezeigte langfristige Entwicklung habe lediglich "Modellcharakter". (fst)