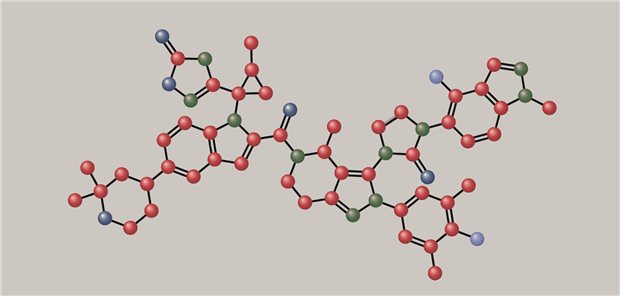Nach der Wahl
Polarisierung – Chance für das Parlament
Gesundheitspolitik in Zeiten der großen Koalition – das stand für die fehlende Konkurrenz der Ideen. Der Souverän hat die Polarisierung gewollt. Das ist eine Chance für die Demokratie.
Veröffentlicht:
Ärzte: vor und nach der Wahl.
© Tomicek
Zurück in die Zukunft: Wer im Internet Parlamentsdebatten oder "Elefantenrunden" Revue passieren lässt – die ihren Namen damals noch zu recht trugen–, der bekommt einen Eindruck von der Härte politischer Auseinandersetzungen etwa in den 70er oder 80er Jahren.
Ihre Meinung zum Wahlausgang
Uns interessiert: Wie beurteilen Sie selbst das aktuelle Wahlergebnis?
Schreiben Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an gp@springer.com
oder posten Sie Ihren Kommentar auf unserer Facebook-Seite – bzw. gleich hier auf der Webseite.
Ob Kalter Krieg, deutsche Teilung oder die Ostverträge – Regierung und Opposition boten alternative Konzepte an, um die im Wortsinn gerungen wurde. Die Bundestagswahl am Sonntag hat Deutschland eine neue Polarisierung beschert, wie sie es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat. Das mag man bedauern oder begrüßen. Für den Bundestag als Vertretung des Volkes könnte sich dies rückblickend als ein Glücksfall herausstellen, und zwar trotz des Einzugs einer rechtspopulistischen Partei mit dem ihr eigenen Jargon.
Friedhof der Kuscheltiere
Opposition – das war in den vergangenen vier Jahren ein Friedhof der Kuscheltiere. Grüne und Linke fristeten ein wenig beachtetes Dasein in einem Reservat des Parlaments. Regierungsbefragungen boten in Zeiten der großen Koalition ein jämmerliches Bild, bei der Tristesse und Langeweile regierten. Im britischen Unterhaus dagegen ist die Fragerunde, die "Prime Minister's Question Time", ein allwöchentlicher Höhepunkt, bei dem sich Regierung und Opposition einen Schlagabtausch liefern, der sich gewaschen hat. Der wütendste Gegner des hiesigen Niedergangs der parlamentarischen Debattenkultur war Bundestagspräsident Norbert Lammert. Zu den wenigen erinnerungswürdigen Momenten in der vergangenen Legislatur gehört sein Wutausbruch, mit dem er einen Minister in die Fragerunde des Parlaments zitieren ließ. Die "Groko" hatte es als ausreichend befunden, dass nur ein Staatssekretär den Volksvertretern Rede und Antwort steht.
Das alles wird mit der konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestags Vergangenheit sein. Die SPD kann sich programmatisch neu aufladen, ohne den Ballast koalitionärer Verpflichtungen immer mitdenken zu müssen. SPD und der Linken fällt die Aufgabe zu, die Regierung zu kontrollieren und sich als programmatische und personelle Alternative zur Regierungsmehrheit zu positionieren. Welche Rolle die AfD als neue Fraktion sich selbst zuschreibt, ist einstweilen nicht abzusehen.
Auch die Gesundheitspolitik kann programmatisch von einer neuen Polarisierung profitieren. Der sedierende Wahlkampf der CDU unter Bundeskanzlerin Merkel fand seinen Höhepunkt in einem Wahlprogramm, das keines war: "Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben." Darin machte die Union erst gar keinen Versuch, einen Zukunftsentwurf für das Land zu beschreiben, auch nicht für die Gesundheitspolitik. Man beließ es bei der Feier des Status quo.
Der Souverän hat der Union einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie hat nun, im laufenden Regierungsbetrieb, das härteste Reformprogramm vor sich. Sie muss, wie von CSU-Chef Horst Seehofer dekretiert, die "rechte Flanke" abdichten und sich zugleich hübsch machen für eine Koalition mit zwei Partnern, die – siehe Klima, Digitalisierung, Bildung – eine ganz andere Agenda als die Union verfolgen – kann das klappen?
Und welche Bedeutung hat das Wahlergebnis für die künftige Gesundheitspolitik – womit müssen Ärzte rechnen? Die große Koalition kassierte für ihre Gesundheitsgesetze von den Lesern der "Ärzte Zeitung" in einer Vorwahlumfrage eine schallende Ohrfeige. Das Votum der über 1540 Teilnehmer war eindeutig. Niederlassungsförderung: unwirksam; Innovationsfonds: unwirksam; Förderung der Weiterbildung: unwirksam; Fristen für Telemedizin: unwirksam; Medikationsplan: unwirksam. Für Minister Herrmann Gröhe, der nicht weniger als 28 Gesetze und 40 Verordnungen durchgesetzt hat, war das ein "mangelhaft".
Die FDP als Ärzteversteher?
Doch wer soll's richten? Wer kann's besser? Gebetsmühlenartig sind in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder die Freidemokraten als Ärzteversteher favorisiert worden. Zudem hieß es: Nur ein Arzt habe tatsächlich ein offenes Ohr für die Probleme der Ärzte. Mit Philipp Rösler bekam man gleich beides: Gut eineinhalb Jahre (Oktober 2009 bis Mai 2011) machte er den Job. Sein Nachfolger Daniel Bahr hatte zweieinhalb Jahre Zeit, bei den Ärzten zu reüssieren. In beiden Amtszeiten gab es Streit und Streiks – bisweilen mit Androhungen, die Kassenzulassung zurückzugeben.
Schließlich hat man auch Erfahrungen mit einer grünen Gesundheitsministerin gemacht – zwischen 1998 und 2001. Zur Erinnerung: Damals stimmte unter Andrea Fischer die Chemie überhaupt nicht. Noch heute sind einzelne KV-Vertreter von der Erfahrung einer Zwangsehe mit ihrem KV-Nachbarn traumatisiert. Festzuhalten ist: Grüne und FDP sind beides Parteien mit einer eigenen gesundheitspolitischen Expertise.
Hermann Gröhe hat aus seiner Sicht einen Plan, wie es weitergehen könnte, etwa mit einer dualen Krankenversicherung, allerdings nicht unter dem Dach einer Bürgerversicherung, oder mit der Reform der GOÄ, die mit dem EBM zusammengeführt werden könnte, wie dies Stimmen auch innerhalb der CDU fordern.
Jamaika – keine Urlaubsstimmung
Gröhes größte Baustellen aber sind die Reform der Kassenfinanzierung, die Schnittstellen zwischen Klinik und Praxis und nicht zuletzt die Pflegeversicherung – übrigens das einzige Gesetz, das von Ärzten in der Umfrage als wirksam bezeichnet wurde. Am Ende könnte sich zeigen, dass "Jamaika" ein viel zu positiv besetzter Begriff ist, weil sich im Falle einer Einigung dahinter alles andere als weißer Strand und Urlaubstimmung verbirgt.
Gesundheitspolitik in Zeiten einer neuen Polarisierung und einer Jamaika-Koalition: Die Agenda wird sich ändern, das Wie steht in den Sternen.