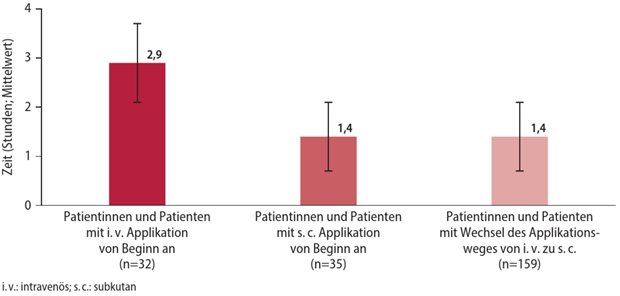Mittels Software
Corona-Übertragungswege an Krankenhäusern aufspüren
Die Göttinger Universitätsmedizin hat eine Software entwickelt, die Übertragungswege von Infektionsketten aufspürt.
Veröffentlicht:Göttingen. Ein computerbasiertes Frühwarnsystem soll dabei helfen, frühzeitig SARS-CoV-2-Infektionen in Krankenhäusern zu erkennen und mögliche Übertragungswege aufzuspüren.
Die neue Software „SmICS“ (Smart Infection Control System), die von Forschern der Göttinger Universitätsmedizin (UMG) mitentwickelt wurde, ist seit Mitte Mai im Rahmen einer Pilotstudie an drei Uni-Kliniken im Einsatz.
Zu ihnen gehören neben der Universitätsklinik Göttingen auch die Medizinische Hochschule Hannover und die Berliner Charité. Die Software stehe aber auch allen anderen Universitätskliniken zur Verfügung, teilte die UMG mit.
Erkennung von Infektionsclustern als Ziel
Im Kampf gegen die Corona-Pandemie spiele eine möglichst frühzeitige Verhinderung von Infektionen in Krankenhäusern, anderen Gesundheitseinrichtungen und Seniorenheimen eine zentrale Rolle, sagt die Direktorin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektiologe an der UMG und klinische Leiterin des Projekts, Professor Simone Scheithauer.
Bislang gebe es jedoch bei der Erkennung von möglichen Infektionsclustern und Ausbrüchen das Problem, dass oft zwar zahlreiche Informationen verfügbar seien. Diese seien aber in unterschiedlichen IT-Systemen gespeichert und nicht miteinander verknüpft.
Verknüpfung vorhandener Daten
Genau hier setzt die neue Software an: „Mit SmICS vereinen wir Patienten-, Erreger- und Bewegungsdaten miteinander und stellen sie als Prozesse dar“, erläutert Scheithauer. Das System verknüpft nicht nur mikrobiologische oder virologische Befunde aus unterschiedlichen Laborinformationssystemen, sondern berücksichtigt auch die verschiedenen Aufenthaltsorte von Patienten in der Klinik.
Diese Informationen werden im medizinischen Datenintegrationszentrum der UMG strukturiert abgelegt, auch epidemiologische Kurven und tagesaktuelle Fallzahlen werden analysiert und visualisiert.
Die Software wurde von dem an der Medizininformatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) beteiligten Konsortiums „HiGHmed“ entwickelt. In dem Konsortium arbeiten Experten für Infektionsprävention und Infektiologie und für Medizininformatik der Gründungsstandorte Göttingen, Hannover und Heidelberg mit dem Robert Koch-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig sowie Visualisierungsexperten der TU Darmstadt zusammen. (pid)