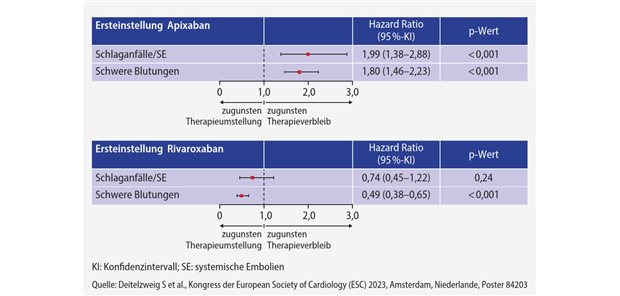Metaanalyse
Wut und Ärger können Schlaganfälle begünstigen
Menschen, die sich häufig aufregen, sind gefährdeter für einen Schlaganfall, zeigen Studien. Eine Metaanalyse offenbart aber auch: Das gilt nicht für alle. Möglicherweise spielt der Status der Person eine Rolle.
Veröffentlicht:
Ob Wut und Ärger tatsächlich das Schlaganfallrisiko hochtreiben, lässt sich jedoch schwer sagen, da wütende Personen vermehrt andere Schlaganfallrisikofaktoren haben.
© Thomas Perkins / stock.adobe.com
SHENYANG. Wenn Wut und Zorn den Blutdruck hochtreiben, liegt der Verdacht nahe, dass damit auch das Schlaganfallrisiko steigt. Epidemiologische Studien liefern dazu jedoch wenig belastbare Daten.
Manche sprechen für ein erhöhtes Schlaganfallrisiko unter eher cholerischen Mitmenschen, in anderen scheint der Stressabbau durch Wutausbrüche protektiv zu wirken.
Sieben Kohortenstudien ausgewertet
Neurologen um Dr. Hanze Chen von der Universität in Shenyang in China kommen anhand einer Metaanalyse von sieben Kohortenstudien nun zu dem Schluss, dass die Evidenz eher für als gegen ein erhöhtes Schlaganfallrisiko bei zu Wutausbrüchen und Feindseligkeiten neigenden Menschen spricht (J Neurol 2019; Volume 266, Issue 4, pp 1016–1026).
An den sieben Studien, fünf aus den USA, zwei aus Europa, hatten rund 52.300 Personen teilgenommen. Zwei Studien gingen der Frage ausschließlich bei Männern, eine nur bei Frauen nach, in fünf betrug die Nachbeobachtungsdauer mehr als fünf Jahre, in zwei hatten alle Teilnehmer zu Beginn bereits eine kardiovaskuläre Erkrankung.
Studie mit männlichen Ärzten
Für sich betrachtet, kamen nur zwei der Studien zu einem signifikanten Ergebnis: In einer Untersuchung bei männlichen Ärzten war die Schlaganfallrate bei cholerischen Naturen halbiert.
Eine Studie mit knapp 7000 älteren Männern und Frauen und einer Nachbeobachtungsdauer von über acht Jahren kam hingegen auf eine um rund 60 Prozent erhöhte Rate bei zu Wut und Ärger neigenden Teilnehmern. Von den übrigen Studien deuteten drei tendenziell auf ein erhöhtes und zwei auf ein erniedrigtes Risiko.
Wurden alle Studien entsprechend der Teilnehmerzahl gewichtet, ergab sich eine Risikoerhöhung um 8 Prozent zulasten der häufig verärgerten Teilnehmer, sofern andere bekannte Schlaganfallrisikofaktoren berücksichtigt wurden. Die Differenz erwies sich jedoch als statistisch nicht signifikant.
Um 30 Prozent signifikant erhöhtes Schlaganfallrisiko
Die Forscher bemerkten eine starke Heterogenität. Diese ließ sich fast komplett vermeiden, wenn sie die Studie mit männlichen Ärzten und einer sehr kurzen Nachbeobachtungsdauer ausschlossen. Ohne diese konnten sie ein um 30 Prozent signifikant erhöhtes Schlaganfallrisiko für wütende Zeitgenossen berechnen.
Wurde die Studie mit männlichen Ärzten ausgeschlossen, ergab sich ein signifikanter Zusammenhang für die übrigen US-Studien (37 Prozent Risikoerhöhung), nicht aber für die beiden aus Europa, für Menschen über 60 Jahre (plus 40 Prozent), nicht aber für jüngere, für Studien mit vielen Teilnehmern (plus 45 Prozent), solcher mit hoher Qualität (plus 33 Prozent) und langer Nachbeobachtungsdauer (plus 33 Prozent), nicht aber für Studien mit wenigen Teilnehmern, geringer Qualität und kurzer Nachbeobachtungszeit.
Versuchten die Forscher um Chen zwischen den Endpunkten „Wut“ und „Feindseligkeit“ zu trennen, deutete sich jeweils ein erhöhtes Schlaganfallrisiko an, dieses war jedoch nicht statistisch signifikant.
Status könnte eine Rolle spielen
Ob Wut und Ärger tatsächlich das Schlaganfallrisiko hochtreiben, lässt sich jedoch schwer sagen, da wütende Personen häufiger rauchen, dick sind, sich weniger bewegen und vermehrt andere Schlaganfallrisikofaktoren haben, die sich nicht immer gut voneinander trennen lassen, geben die Forscher um Chen zu bedenken.
In der Studie mit männlichen Ärzten könnte der soziale Status eine wichtige Rolle gehabt haben. Wer es sich leisten kann, seinen Ärger an anderen auszulassen, und damit auch seine Machtposition unterstreicht, kann damit vielleicht gut Stress abbauen und sein Schlaganfallrisiko senken, so die Hypothese der Forscher.
Dies dürfte vermutlich weniger für diejenigen gelten, die einen dicken Hals bekommen, weil sie solche Wutausbrüche ertragen müssen.