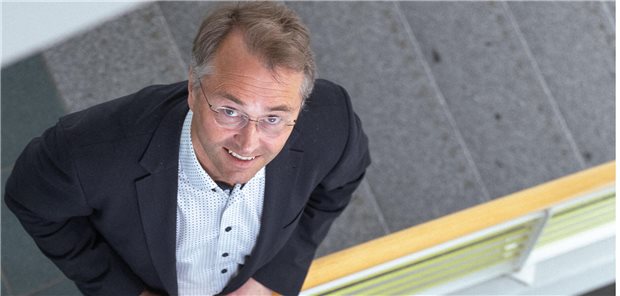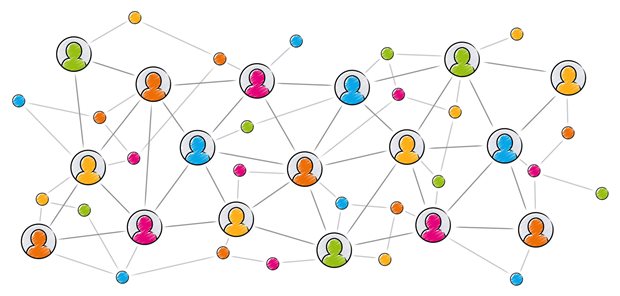"Den Betroffenen werden essentielle Therapien noch immer vorenthalten"
Die meisten Krebspatienten haben aufgrund ihrer Erkrankung Schmerzen, besonders in der letzten Lebensphase. Durch eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Schmerztherapie könnte bei über 90 Prozent dieser Patienten eine ausreichende Schmerzlinderung erzielt werden. Patienten mit starken Schmerzen werden oft zu lange mit Nicht-Opioidanalgetika behandelt, der Wechsel zur Opioidtherapie erfolgt häufig zu spät.
Veröffentlicht:Thomas Nolte
Jahr für Jahr leiden weit mehr als die Hälfte der 250 000 Tumorschmerzpatienten in Deutschland an nicht ausreichend gelinderten Schmerzen. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis Tumorschmerztherapie der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes in einer Untersuchung im Jahre 2003. Den Betroffenen werden essentielle Therapien noch immer vorenthalten. Ursachen dafür sind vor allem
- die mangelhafte Ausbildung im Studium, in dem Schmerztherapie und Palliativmedizin bis heute kaum gelehrt werden,
- eine zu zögerliche und angstbesetzte Umsetzung der Therapierichtlinien zur Tumorschmerztherapie sowie
- weiterhin vorhandene, mythologisch begründete Vorbehalte gegen Opioide.
Allein schon durch den richtigen Einsatz der heute zur Verfügung stehenden therapeutischen Möglichkeiten in der Schmerztherapie könnte bei über 90 Prozent der Tumorschmerzpatienten eine ausreichende Schmerzlinderung erzielt werden. Dabei stirbt niemand früher, weil seine Schmerzen mit Morphin oder anderen Opioiden leitliniengerecht und individuell behandelt werden!
Die Konsequenzen dieser nach wie vor skandalösen Unterversorgung von Patienten, die mit einer Tumorerkrankung leben oder sich in ihrer letzten und schwierigsten Lebensphase befinden, führen zu erheblichen Frustrationen, Enttäuschungen bei den Betroffenen und nicht zuletzt auch zu unnötigen Kosten im Gesundheitswesen: Auf der Suche nach medizinischer Hilfe kommt es zu verzweifelter Inanspruchnahme von medizinischen Maßnahmen, notfallmäßigen Krankenhauseinweisungen wie auch zunehmender Ratlosigkeit und weiterer Verunsicherung durch divergierende Einschätzungen der Prognose und weiteren Therapieangeboten.
Aus dem ärztlichen Bedürfnis und naheliegendem Reflex, in jedem Fall "helfen zu wollen", werden den Patienten kurative Therapievorschläge unterbreitet, die in der Folge durch ihre Nebenwirkungen die verbleibende Lebensqualität des Patienten weiter beeinträchtigen können.
Besonders quälend ist dieser unkoordinierte Hyperaktionismus für die Patienten selbst und deren Angehörige, die sich sowohl im häuslichen Bereich, auf Pflegestationen und nicht zuletzt auch in Krankenhäusern orientierungslos und im Stich gelassen fühlen.
Dies ist um so erschütternder, als es sich in vielen Fällen um die letzten Lebenstage eines Menschen handelt, in denen nicht das Überleben um jeden Preis und jeden Tag primäres Ziel aller therapeutischen Bemühungen und gemeinsamen Anstrengungen sein sollte, sondern der Erhalt oder die Wiedergewinnung der Lebensqualität durch effektive Schmerz- und Symptomkontrolle. Dieser Zeitpunkt wird häufig jedoch nicht erkannt und daher auch nicht entsprechend gehandelt.
WHO-Stufenschema hat sich bewährt, ist aber eigentlich überholt
Das 1986 eingeführte WHO-Stufenschema ist immer noch die Grundlage einer koordinierten und nach wissenschaftlichen Kriterien allgemein akzeptierten medikamentösen Schmerztherapie - auch in der Palliativmedizin. Bei allen bekannten Unzulänglichkeiten dieser Handlungsanleitung würde allein die konsequente Umsetzung dieser Grundsätze bereits zu einer deutlich verbesserten Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen jedweder Genese beitragen.
- Stufe 1: Die Nicht-Opioidanalgetika sind die am weitesten verbreiteten Medikamente, die bei leichteren Schmerzen eingesetzt werden. Gerade bei alten und multimorbiden Patienten mit progressiver Schmerzzunahme ist jedoch die analgetische Potenz unzureichend, zudem ist auch das Nebenwirkungsspektrum für diese Patienten problematisch. Negative Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt, die Leber und die Nieren, die zumeist durch belastende Therapieverfahren zusätzlich beeinträchtigt sind, schränken die Anwendung ein. Trotzdem werden immer noch mehr als zwei Drittel der Schmerzpatienten ausschließlich mit diesen Pharmaka behandelt. Für die Betroffenen sind aber Opioide der Stufe 2 und 3 die Mittel der ersten Wahl.
- Stufe 2 und 3: Morphin als früherer Goldstandard einer Opioidtherapie wird heute mehr und mehr durch synthetische Nachfolgeprodukte wie Buprenorphin (Temgesic®, Transtec®), Fentanyl (Durogesic® SMAT, Actiq®), Hydromorphon (Palladon®) oder Oxycodon (Oxygesic®) abgelöst, da diese besser verträglich sind. Besonders die Beeinträchtigung der Vigilanz, Obstipation und initiale Übelkeit sind deutlich geringer ausgeprägt. Dies führt zu einer höheren Akzeptanz bei den Betroffenen. Wegen des großen Dosierungsspielraums und der zahlreichen Darreichungsformen der Opioide ist meistens eine individuelle Therapieanpassung mit der für ihn bestverträglichen Substanz möglich.
Bei opioidnaiven Patienten hat sich eine niedrige Einstiegsdosis mit von Anfang an retardierten Opioiden bewährt, da durch die langsame Anflutung und den gleichmäßigen Wirkspiegel opioidtypische unerwünschte Wirkungen gerade in der sensiblen Einstellungsphase abgemildert auftreten.
Nach dieser Eingewöhnungszeit von vier bis sieben Tagen kann dann die Dosis weiter erhöht werden - der Bedarf richtet sich nach dem dokumentierten Schmerzniveau. Zusätzlich zum Retardopioid sollte von Anfang an ein kurzwirkendes Opioid oder ein Nicht-Opioidanalgetikum, je nach Schmerzmechanismus, zur raschen Schmerzlinderung bei Durchbruchschmerzen zur Verfügung gestellt werden.
Sich bei der Schmerztherapie am WHO-Stufenschema zu orientieren, ist nach wir vor hilfreich. Jedoch ist die stringente Anwendung bei Patienten mit Tumorschmerzen ein Hindernis für eine effiziente Schmerztherapie. Denn viel zu lange werden Patienten mit starken oder sehr starken Schmerzen anstatt mit einem Opioid mit Analgetika der Stufe 1 behandelt, die sowohl unzureichend wirksam als auch schlecht verträglich sind.
Nicht-Opioidanalgetika und Opioiden der Stufe 2 ist gemeinsam, daß sie Dosisobergrenzen haben. Deren Überschreitung führt zu keiner weiteren Schmerzlinderung, erhöht aber die Nebenwirkungsrate exponentiell.
Komedikation kann Wirkung von Opioiden ergänzen
Außer einer adäquaten Schmerzlinderung ist zudem eine effektive Kontrolle von schwerwiegenden Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Appetitmangel und Schwäche erforderlich. Hier gibt es überprüfte und wirkungsvolle Therapiestandards, die allerdings bislang wenig beachtet werden.
Zumindest die Opioid-typischen Nebenwirkungen wie Obstipation und Übelkeit, gelegentlich Erbrechen, müssen von vorneherein in der Therapieplanung berücksichtigt werden. Dazu gehören in der Regel Laxantien (meist während der gesamten Dauer der Therapie) und in der Initialphase einer Opioidtherapie Antiemetika wie Metoclopramid (etwa Paspertin®) und / oder Haloperidol (etwa Haldol®) in niedriger Dosierung.
Die analgetische Wirkung von Opioiden kann gesteigert werden, indem mit einer auf den Schmerzmechanismus abgestimmten Komedikation kombiniert wird. Bei Depression und Schlaflosigkeit haben sich hier niedrig dosierte trizyklische Antidepressiva bewährt, bei neuropathischen Schmerzformen zusätzlich auch Antiepileptika wie Gabapentin (etwa Neurontin®) oder Pregabalin (Lyrica®).
Bei der Behandlung von Patienten mit schmerzenden Knochenmetastasen sind im Therapieplan auch Bisphosphonate wie Clodronat (etwa Ostac®), Ibandronat (Bondronat®), Pamidronat (etwa Aredia®) oder Zoledronat (Zometa®), zumeist parenteral verabreicht, unverzichtbar. Bei entzündlicher Schmerzgenese wie auch bei Appetitmangel, der vor allem in späteren Krankheitsstadien auftritt, ist auch Cortison in niedriger Dosierung sinnvoll, das antiphlogistisch und auch antianorektisch wirkt.
Dr. Thomas Nolte, Schmerz- und Palliativzentrum Wiesbaden, Hospiz Advena, Kinderhospiz Bärenherz, Blücherplatz 2, 65195 Wiesbaden, Tel.: 0611 / 945-1808, Fax: 945-0849, dr.nolte@schmerzzentrum-wiesbaden.de
Verlaufsdokumentation ist unverzichtbar
Einer der maßgeblichen Gründe für das immer noch dramatische Ausmaß der Unterversorgung bei Patienten mit chronischen Schmerzen oder auch Tumorschmerzen ergibt sich aus der bis heute noch nicht standardmäßig etablierten Schmerzmessung, zum Beispiel mit der Visuellen Analogskala (VAS) oder der Numerischen Analogskala (NAS).
Außerdem fehlen weit verbreitet Dokumentationsinstrumente in der Palliativmedizin, mit der die Erfassung der verschiedenen Parameter zeitabhängig und standardisiert möglich ist und aus der dann therapeutische Konsequenzen gezogen werden können.
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann eine qualitätsorientierte und leitliniengestützte Therapie von Patienten mit Tumorschmerzen gelingen.
Vor Beginn einer differenzierten Schmerztherapie steht eine differenzierte Schmerzdiagnose. Zu dieser gehört eine mehrdimensionale Einstufung des Schmerzes nach
- den Ursachen: - tumorbedingt - therapiebedingt - tumorassoziiert - tumorunabhängig
- nach dem zeitlichen Verlauf: - Akutschmerzen (meist abklärungsbedürftig) - Dauerschmerzen - Durchbruchschmerzen
- nach den Entstehungsmechanismen der Schmerzen: - nozizeptiv - neuropathisch - viszeral - somatoform - gemischt
Aus dieser Erhebung der verschiedenen Komponenten ergibt sich ein individueller Therapieplan, der außer einer Pharmakotherapie auch palliativtherapeutische Maßnahmen (Bestrahlung, Chemotherapie, Operation), Psychotherapie, Physiotherapie und psychosoziale Begleitung mit einschließt. (Nolte)