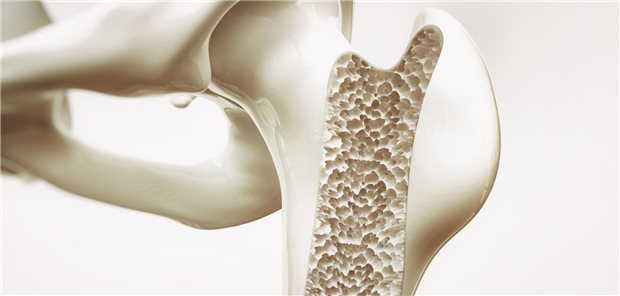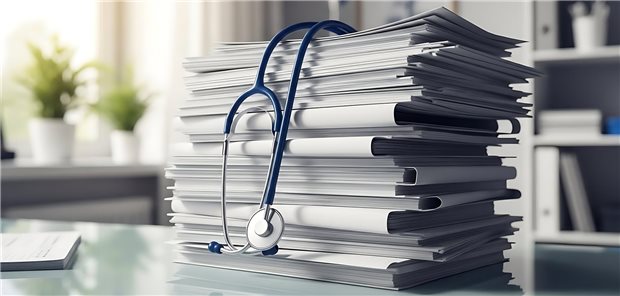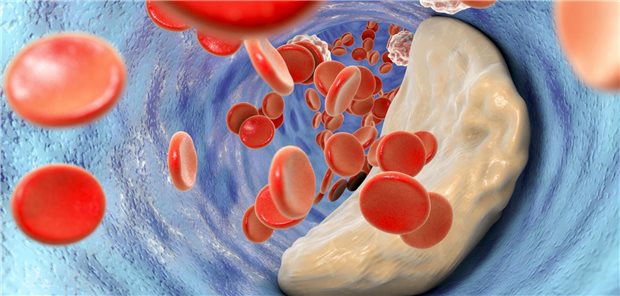Happy Birthday Mutterschutzgesetz
Schwangere Politikerinnen machen derzeit Schlagzeilen. Einige ihrer Vorgängerinnen dürften dazu beigetragen haben, dass am 6. Februar 1952 das Mutterschutzgesetz verabschiedet wurde. Doch bereits 1878 traten die ersten Schutzregelungen in Kraft.
Veröffentlicht:
Chacon, Schröder, Nahles: Drei Frauen aus der Politik, die das Kinderkriegen mit ihren Job verbunden haben.
© dpa
"Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklären; die Erklärung kann jederzeit widerrufen werden."
So heißt es in Paragraf 3, Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes, das eines der wichtigsten familienpolitischen Grundsätze der deutschen Nachkriegsgeschichte darstellt.
Wenngleich für Beamtinnen inzwischen spezifische Regelungen gelten, profitieren auch Jungmütter wie die SPD-Politikerin Andrea Nahles und die schwangere CDU-Ministerin Kristina Schröder von den erstmals am 6. Februar 1952 in Kraft getretenen Bestimmungen.
Ein dreiwöchiges Arbeitsverbot für Fabrikarbeiterinnen, 1878 in einer Novelle der Gewerbeordnung festgeschrieben, markiert den Anfang des gesetzlichen Mutterschutzes in Deutschland.
Wie Karin Hauser in ihrer rechtswissenschaftlichen Dissertation aus dem Jahr 2004 ("Die Anfänge der Mutterschaftsversicherung") ausführt, hatte die Süddeutsche Volkspartei bereits 1868 ein "Verbot der Frauenarbeit in angemessener Frist vor und nach dem Wochenbett" gefordert.
Lohnfortzahlung startete bereits 1883
Fünf Jahre später wurde das auch vom sozialdemokratischen Arbeiterführer Friedrich Wilhelm Fritzsche aufgegriffen, der ein vierwöchiges Arbeitsverbot für Arbeiterinnen nach der Geburt verlangte.
Ein 1877 von der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion eingebrachter Gesetzesentwurf für ein Arbeiterschutzgesetz enthielt die Forderung nach einem Mutterschutz von drei Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung.
Der dreiwöchige Wöchnerinnenschutz für Fabrikarbeiterinnen, der schließlich 1878 den Reichstag passierte, verzichtete allerdings auf Lohnfortzahlung und Kündigungsschutz.
Das änderte sich erst mit dem Krankenversicherungsgesetz von 1883. Schon 1875 hatte der Wiener Dozent Eduard Lewy die Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte dazu gebracht, eine Resolution mit Forderung nach einem zwölfwöchigen Mutterschutz und einer Lohnfortzahlung aus der Fabrikkrankenkasse zu beschließen.
Diese Initiative wurde 1883 vom Reichstag aufgegriffen, womit Deutschland erstmals ein duales, richtungsweisendes Gesetzesmodell mit arbeitsrechtlichem Wöchnerinnenschutz und versicherungsrechtlicher Wöchnerinnenunterstützung einführte.
Zudem bezog sich das Krankenversicherungsgesetz von Anfang an nicht mehr allein auf die Fabrikarbeiterinnen, sondern auf alle im Handwerk und in sonstigen Gewerbebetrieben abhängig beschäftigten Frauen.
EU plant eine Ausweitung des Mutterschutzes
Infolge zweier Weltkriege sah sich Deutschland Ende der 1940-er Jahre mit großer Armut und einem noch größeren Arbeitskräftemangel konfrontiert.
Die meisten Frauen mussten Beruf und Familie unter einen Hut bekommen, und die Gewerkschaften übten auf die Arbeitgeber Druck aus, die soziale Situation der Beschäftigten zu verbessern.
Am 24. Januar 1952 verfassten die bundesdeutschen Parlamentarier ein "Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG)", das am 6. Februar 1952 in Kraft trat und im Wesentlichen noch heute gültig ist.
Darin festgeschrieben sind Beschäftigungsverbote für Schwangere und Mütter nach der Entbindung, Schutzvorschriften am Arbeitsplatz, das Recht auf regelmäßige Stillzeiten, ein Kündigungsverbot sowie Regelungen zum Mutterschaftsgeld.
Im vergangenen Jahr beschloss das EU-Parlament, den Mutterschutz von 14 auf 20 Wochen zu verlängern. Das würde den deutschen Müttern sechs Wochen zusätzliche Babypause erlauben.
Allerdings hat die deutsche Bundesregierung bereits Widerstand gegen diese Initiative angekündigt. 14 Wochen Schonzeit bei anschließender Elternzeit seien ausreichend, sagte Familienministerin Kristina Schröder nach dem EU-Beschluss Ende Oktober.
Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass die Ministerin im Juli selbst ihr erstes Kind erwartet.