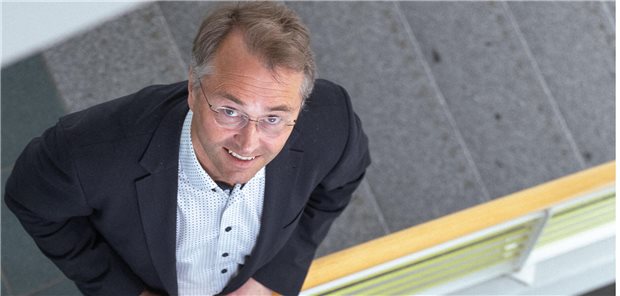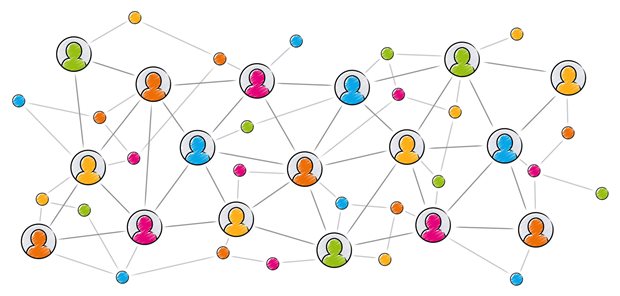Interview mit AOK-Chef Litsch
"Das wäre ein Paradigmenwechsel"
Dass Gesundheitsminister Spahn immer öfter in den Aufgabenbereich der Selbstverwaltung eingreift, sieht AOK-Chef Martin Litsch kritisch. Dadurch werde Versorgung noch nicht besser. Im Interview erläutert er, warum es vor allem flexibel und regional gedachte Strukturen braucht.
Veröffentlicht:
Martin Litsch (Mitte), Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, Dr. Kai Behrens (links) und Peter Willenborg von der AOK im Gespräch mit Wolfgang van den Bergh und Rebekka Höhl von der „Ärzte Zeitung“.
© Stephanie Pilick
Ärzte Zeitung: Herr Litsch, beim Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) biegen wir auf die Zielgerade ein. Zur ersten Anhörungen hatten Sie 200 Seiten im Gepäck. Nun sind einige Themen hinzugekommen, mussten Sie Zusatzgepäck anmelden?
Martin Litsch: Wir sind in einer sehr ambitionierten Gesetzgebungszeit. Ein Gesetz jagt das andere, gespickt mit massiven Änderungsanträgen, die das Format haben, die ganze SGB-Logik ins Wanken zu bringen. Nehmen Sie etwa den Heilmittelbereich: Hier werden Höchstpreisregelungen und zentrale Verhandlungen für die ganze Republik eingeführt.
Diese hohe gesetzgeberische Taktung ist sicher nicht nur für uns Kassen und Verbände, sondern auch für die Parlamentarier eine Herausforderung… Deshalb ja, wir brauchen das Zusatzgepäck.
Für Irritationen hat ein Antrag gesorgt, wonach das BMG künftig darüber entscheiden kann, ob Leistungen von den Kassen erstattet werden sollen oder nicht. Das wäre ein Paradigmenwechsel…
Litsch: Das wäre ein echter Paradigmenwechsel – und der geht überhaupt nicht. Damit würden wir uns letztlich von der Art verabschieden, wie wir heute gemeinsam mit den Ärzten, die die Leistung erbringen, den Kassen, die sie bezahlen, und dem IQWiG als neutraler und wissenschaftlicher Instanz den Nutzen und die Qualität von medizinischen Leistungen beurteilen.
Wenn es jetzt politisches Geschäft wird, dass der Minister entscheidet, was Evidenz bedeutet, dann führt das zu eminenzbasierten Entscheidungen und beschädigt ein rationales Grundelement unseres Systems.
Fürchten Sie hier einen Qualitätsverlust?
Litsch: Auf jeden Fall. Wir haben einige Hinweise darauf, dass die Qualitätsagenda von Herrn Gröhe, die in den Gesetzen der letzten Legislaturperiode umgesetzt wurde, Schaden genommen hat. So ist beispielsweise der feste Wille zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität, der bei der Verabschiedung des Krankenhausstrukturgesetzes zu spüren war, in der aktuellen Krankenhaus-Gesetzgebung der Großen Koalition nicht mehr erkennbar.
Minister Spahn hat das seinerzeit damit begründet, dass sich der GBA bei manchen Entscheidungen zu viel Zeit lasse. Hat er Recht?
Litsch: Der GBA leistet enormes, 95 Prozent seiner Arbeit finden völlig geräuschlos und hochgradig professionell statt. Das, was in der öffentlichen Diskus-sion kritisiert wird, ist die kleine Spitze eines Eisberges. Sicher, an manchen Stellen gibt es Probleme und kontroverse Diskussionen, dann dauert es länger.
Deshalb kann man die Frage stellen, wie sich Verfahren beschleunigen lassen. Eine Lösung wäre, dass man den Vorsitzenden eine entsprechende Rolle gibt. Das ist etwas anderes, als wenn das Ministerium entscheidet.
… dennoch, bei der Liposuktion hat der GBA schnell einen Vorschlag geliefert. Hat am Ende doch der Druck dazu geführt, zumindest eine vor-übergehende Regelung zu finden?
Litsch: Die Reaktion ist in der Tat politisch taktisch zu sehen. Das Lipödem ist keine SpaßkranDkheit. Sie hat mit Schmerzen zu tun und es gibt keine vernünftige Therapie. Ob die Liposuktion jetzt tatsächlich eine gute Idee ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass sie eine Menge Nebenwirkungen hat. Und deswegen ist die Studie tatsächlich notwendig.
Wenn der Minister das nicht abwarten kann, dann haben wir ein Problem. Das sind die Spielregeln. Der GBA versucht nun, den Druck aus dem Kessel zu nehmen, und sagt, wir bleiben bei unseren Spielregeln, Evidenz muss sein, aber für die schwersten Fälle ermöglichen wir einen Zugang zum Leistungskatalog unter bestimmten Bedingungen. Das ist ein Versuch, gesichtswahrend für beide Seiten eine Lösung zu finden. Aber das sollten wir nicht zu oft wiederholen.
Als einen weiteren Eingriff in die Selbstverwaltung bezeichnen Sie den Änderungsantrag, wonach die Vergütungen von den Diagnosen entkoppelt werden sollen. Warum gefährdet das innovative Versorgungsverträge?
Litsch: Dass es keine Bezahlung für das bloße Aufschreiben einer Krankheit geben darf, steht außer Frage. In den Verträgen, mit denen wir Leitlinien-orientierte, aber auch sektorübergreifende Versorgung fördern wollen, müssen wir uns aber sehr präzise mit einzelnen Erkrankungen beschäftigen und diese eingrenzen.
Ein Beispiel: Beim kleinzelligen Lungenkarzinom gibt es therapeutische Möglichkeiten, die eine bestimmte genetische Disposition voraussetzen. Hier kann ich in den Versorgungsvertrag nicht einfach Krebs oder Lungenkrebs schreiben. Das gleiche gilt für Verträge zum Diabetischen Fußsyndrom. Dafür haben wir endcodierte ICD-Codes, die müssen wir auch nutzen dürfen. Zudem werden jetzt durch das TSVG Kodierrichtlinien eingeführt. Das sorgt für eine sichere Kodierung.
In der Begründung zu dem Antrag wird unterstellt, dass dadurch Kodieranreize geschaffen werden. Was halten Sie dem entgegen?
Litsch: Ganz einfach: Der Vertragsgegenstand bezieht sich nur auf diese spezifische Krankheits-Ausprägung. Und ich brauche ja rechnungsbegründende Unterlagen für die Versorgung. Noch einmal: Bei der Kodierung darf keine Manipulation möglich sein. Deshalb gibt es das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG, Anm. der Redaktion: Im Huckepackverfahren mit dem Gesetz wurde z.B. das Nachkodieren untersagt) und eine dezidierte Stellungnahme der AOK gegen Manipulationen beim Kodieren, also eine Art Selbsterklärung. Der AOK ist es wichtig, dass damit seriös umgegangen wird.
Thema Digitalisierung: 2021 soll die elektronische Patientenakte eingeführt werden – zu spät, haben Sie vielfach moniert. Was macht die AOK bei ihrem "Akten-Projekt", dem Digitalen Gesundheitsnetzwerk besser?
Litsch: Hier muss man verschiedene Aspekte betrachten. Wir denken unser "Digitales Gesundheitsnetzwerk" nicht als Ansammlung von Informationen, die in irgendein Verzeichnis gestellt werden, sondern wir denken die Patientenakte vom Versorgungsprozess her. Unsere Philosophie ist, dass wir dem Patienten, den Ärzten und anderen Leistungserbringern ermöglichen, auf die Daten zuzugreifen, die ohnehin erhoben werden, wenn der Patient seine Wege durchs Gesundheitswesen nimmt.
Das hat den Vorteil, dass der Arzt nicht zugeschüttet wird mit Daten, sondern die Information erhält, die für sein Fachthema relevant ist. Dafür müssen wir die Leistungserbringer vernetzen, und wir brauchen Standards und Interoperabilität. Austausch und die Verarbeitung der Daten müssen bei allen Akteuren nach gleichen Regeln funktionieren. Bis man das umgesetzt hat, dauert es. Es wird also nicht so sein, dass am 1.1.2021 eine Akte für alle Fragestellungen plötzlich da ist.
Wir sind aber auf einem guten Weg, vor allem, weil wir in unserem Piloten in Mecklenburg-Vorpommern die Machbarkeit in der praktischen Anwendung auf den Prüfstand stellen. Und wir haben seit Kurzem hier in Berlin eine sehr fruchtbare Kooperation mit Vivantes und Sana, die Vorbildcharakter hat. Die Kliniken sind in Sachen Vernetzung ohnehin extrem interessiert.
Der zweite Aspekt ist: Wir müssen für solche Patientenakten und Netzwerke – die Versicherten, Leistungserbringern und Kassen gleichermaßen nutzen – Geld in die Hand nehmen. Dafür brauchen wir einen Rechtsrahmen, der uns das erlaubt. Dafür eignet sich nur der Paragraf 67 SGB V, der jetzt mit dem TSVG angepasst werden soll.
Sie sind durchaus auch ein Kritiker der Strukturen in der gematik. Wie werten Sie die Pläne von Jens Spahn, das Gesundheitsministerium künftig zum Mehrheitsgesellschafter aufzuwerten? Schafft das mehr Tempo?
Litsch: Der Schritt des Ministers hilft uns – gerade auch mit Blick auf die Aufgabe für die Kassen, eine elektronische Patientenakte zu schaffen – nicht. Unser Problem ist, dass der Aufgabenzuschnitt der gematik in den heutigen Strukturen nicht dazu führen kann, dass die Akteure zu Lösungen kommen. Wir brauchen eine Aufteilung von Standardisierung und Zertifizierung, heute macht die gematik beides.
Die gematik soll zertifizieren, aber die Produktentwicklung und Standardisierung müssen wir machen. Wir haben – sowohl bei Software als auch Hardware – internationale Konzerne am Markt, die alle die gängigen Datenstandards wie IHE oder HL7 unterstützen. Anstatt diese internationalen Standards einfach umzusetzen, werden sie in der Spezifikation für die elektronische Patientenakte, die im Dezember veröffentlicht wurde, zu deutschen Sonder-Standards umdefiniert.
Das ändern wir nicht, indem jetzt das BMG die Mehrheitsverhältnisse der gematik übernimmt. Das ist so ähnlich wie beim GBA, nur weil jetzt im Zweifel der Minister entscheidet, was richtig und falsch sein soll, haben wir noch kein produktives Ergebnis.
Welche Rolle wird – angesichts des Ärztemangels – das Thema Digitalisierung, Telemedizin und Telekonsil künftig in der flächendeckenden Versorgung spielen?
Litsch: Es wird viel mehr telemedizinische Versorgung geben, und es wird mehr Austausch von Daten geben. Mit dem Mehr an Daten lassen sich Versorgungsprozesse natürlich auch besser gestalten. Wir werden, was die Allokation von Leistungen betrifft, hoffentlich spezialisierter werden. Gleichzeitig müssen wir aber in der Fläche präsent bleiben. Deshalb arbeiten wird ja auch mit Hochdruck an der Patientenakte. Die Verfügbarkeit von Daten muss ortsunabhängig sein.
Gerade bei der telemedizinischen Versorgung von noch unbekannten Patienten müssen wir allerdings noch Erfahrungen sammeln und genau hinterfragen, was dort eigentlich stattfinden kann und soll. Es ist nun einmal ein Unterschied, ob ich ein telematisch übertragenes Bild habe oder der Patient vor mir sitzt und ich ihn mit allen Sinnen wahrnehme.
Würden Sie so weit gehen und sagen, wir bekommen da neuen Schwung in unsere Diskussion über die Vernetzung ambulant – stationär?
Litsch: Ich habe große Hoffnung, dass wir über den Digitalisierungsweg mehr Gestaltungsräume erschließen, gerade auch was die Versorgung in ländlichen Regionen betrifft. Wir haben in der stationären Versorgung ja auch ein großes Finanzierungsproblem, weil die Investitionen aus den Ländern fehlen. Wir müssen auf jeden Fall zu spezialisierteren Krankenhausstrukturen kommen. Das heißt aber nicht, dass wir einen Kahlschlag machen. Sondern dass wir Krankenhausleistungen vielleicht auch ein bisschen anders organisieren und das Wettbewerbsdenken der Sektoren aufweichen. Das hat natürlich auch mit Vergütung zu tun. Aber, das muss man regional betrachten.
Die Versorgung auf der Schwäbischen Alb funktioniert anders als im Ruhrgebiet. Natürlich ist es bisweilen auch sinnvoll, Krankenhäuser zu Gesundheitszentren umzuwandeln. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn für bestimmte Eingriffe in einem solchen Zentrum eine Übernachtungsmöglichkeit hergestellt würde, ohne dass man da gleich wieder einen Krankenhausplan für braucht.
Es gibt nach wie vor die Schieflage zwischen der Versorgung in Ballungszentren und der Fläche. Wie kriegen wir die Balance wieder hin?
Litsch: Wir werden noch in diesem Monat eine Kampagne zur ländlichen Versorgung starten. Es wird nur funktionieren, wenn man auf mehrere und eben nicht auf Einzelmaßnahmen fokussiert. Wir brauchen natürlich mehr Flexibilität bei der Umwandlung von Krankenhäusern, wir brauchen MVZ, wir brauchen aber auch mehr Steuerung, was die Arztniederlassung betrifft.
Zulassungsausschüsse sind doch paritätisch von Kassen und KV besetzt...
Sicherlich, die Zulassungsausschüsse müssen da auch ihren Job machen. Wir müssen uns aber ebenso die Frage nach der Delegation oder – ich weiß, ein böses Wort – sogar der Substitution von Leistungen stellen. Telemedizinische Aspekte werden eine Rolle spielen. Und es muss vor Ort mit den Akteuren organisiert werden… wir sind als AOK bereit, da mit zu gestalten. Es gibt bundesweit eine Menge sehr vielversprechender Initiativen, die vor Ort auch Wirkung zeigen, die aber nicht alle bundesweit gleichartig funktionieren. Das entsteht auch nicht durch ein Gesetz aus Berlin… das muss erarbeitet werden.
In diesem Kontext spielt die Arbeitszeit des Arztes eine große Rolle. Stichwort Flexibilisierung. Kollege von Stackelberg hat kürzlich geäußert, dass Flexibilität – etwa Sprechstunden abends oder samstags – durchaus zusätzlich vergütet werden kann. Sehen Sie das auch so?
Litsch: Flexibilität ist super, dass anzureizen auch. Der Arzt ist ja auch ein Dienstleister. Natürlich ist es für berufstätige Patienten sinnvoll, wenn sie abends oder auch am Wochenende einen Arzt aufsuchen können. Das ist eine Form, telemedizinische Lösungen oder Delegation sind andere Formen von Flexibilisierung. Ich glaube, dass alles zusammen Sinn macht.
Die Kassen beklagen sich darüber, dass es ein Ungleichgewicht bei der Behandlung von GKV- und PKV-Patienten gibt. Unterstellt, es gibt diesen Unterschied: Wie löst man das Problem?
Litsch: Am Ende wahrscheinlich nur mit Transparenz. Es gibt ungefähr zehn Prozent Privatpatienten. Wenn man jetzt pauschal sagen würde, zehn Prozent der ärztlichen Arbeitszeit geht für die Privatmedizin drauf, dann macht man wahrscheinlich einen Fehler. Denn es gibt Ärzte, die fast gar keine Privatpatienten behandeln und andere, die sehr viele Privatpatienten versorgen.
Mit einem Mittelwert kommt man also nicht so weit. Tatsache ist aber, dass die Spielregeln für GKV- und Privatpatienten unterschiedlich sind und die Ärzte unterschiedlich darauf reagieren. Außerdem gibt es auch Ärzte, die bei gesetzlich Versicherten eine gewisse kaufmännische Kompetenz an den Tag legen und Leistungen verkaufen – Stichwort IGeL.
Von daher wäre es wichtig zu wissen: Stehen die Ärzte auch in dem Umfang für die gesetzliche Krankenversicherung zur Verfügung, für die sie ihre Zulassung haben? Um das Thema rankt sich ja auch die 25-Stunden-Diskussion. Keiner behauptet, dass die Ärzte zu wenig arbeiten, aber arbeiten sie sozusagen für den Richtigen?
Martin Litsch
- Aktuelle Position: Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes (seit 2016)
- Ausbildung: Litsch studierte Soziologie und Ökonomie in Trier.
- Karriere: 1989 startete er seine Laufbahn bei der AOK, zunächst im Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO), dessen Leitung er später übernahm. Als Projektleiter Change Management des AOK-Bundesverbandes und Geschäftsführer der AOK Consult GmbH übernahm er später andere Aufgabenbereiche. 2002 wechselte er zur AOK Westfalen-Lippe, wo er 2008 zum Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde. Unter seiner Führung fusionierten 2010 die AOK Westfalen-Lippe und die AOK Schleswig-Holstein zur AOK NORDWEST.