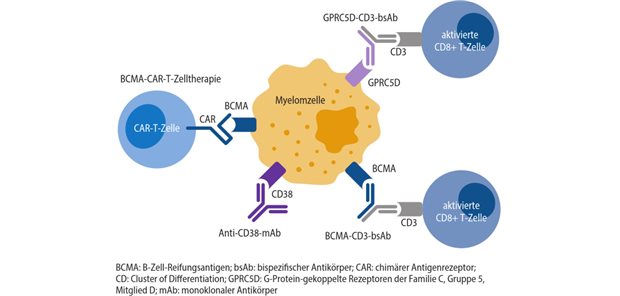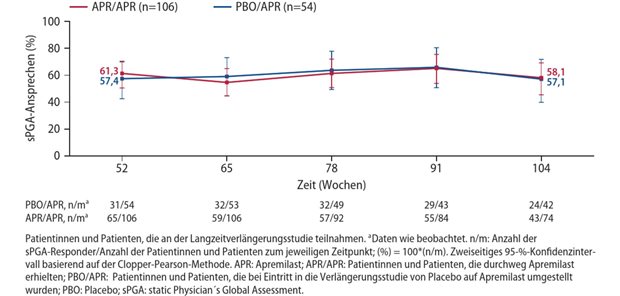Erbkrankheit
Defekter Proteinabbau aktiviert das Immunsystem
BERLIN. Forscher der Charité - Universitätsmedizin Berlin haben in Kooperation mit Wissenschaftlern des National Institute of Health (Bethesda, USA) herausgefunden, dass ein Defekt in den Proteasomen, der Entsorgungsmaschinerie für fehlerhafte Proteine, das Immunsystem aktiviert, teilt die Charité Berlin mit.
Die Forscher sind dem Zusammenhang anhand der seltenen Erbkrankheit, dem Proteasomen-assoziierten autoinflammatorischen Syndrom (PRASS) auf den Grund gegangen (J Clin Invest 2015; online 20. Oktober).
Bei Betroffenen wird der Proteinabfall nicht ausreichend entsorgt. Charakteristisch für das Krankheitsspektrum sind chronische Hautentzündungen mit einem Verlust von Unterhautfettgewebe, Fettfehlverteilung am Körper und wiederkehrendes Fieber. Frühere Untersuchungen an PRASS-Patienten haben auf Veränderungen in einem Bauteil des Immunoproteasoms schließen lassen.
In der aktuellen Studie konnten die Forscher nun auch Veränderungen in anderen Bauteilen des Standard- und Immunoproteasoms identifizieren, die zu einer verschlechterten Abbaukapazität durch das Proteasom und zur Ansammlung von Proteinabfall in den Zellen führt.
Der Rückstau des Proteinmülls wiederum schaltet die Produktion von weiteren Interferonen an. Das sei an sich positiv, da sie die Abwehr gegen Eindringlinge fördert, erklärt Professor Elke Krüger von der Charité in der Mitteilung.
Die Interferonantwort führe bei den Patienten aber zu einem Teufelskreis, weil sie die Schäden an den Zellbausteinen verstärkt und eine überschießende Entzündungsreaktion auslöst.
Modellhaft konnte dies auch an gesunden Zellen, die mit Proteasom-Hemmern behandelt wurden, nachgestellt werden. "Die Entschlüsselung des genauen Mechanismus von der Botschaft ‚Müllansammlung‘ bis zur letztlichen Herstellung der Interferone, wird das Ziel unserer Forschung für die nächsten Jahre sein," wird Dr. Anja Brehm, die Erstautorin der Studie zitiert.
"Aber wir haben bereits jetzt einen besseren Weg gefunden, die Erkrankung zu diagnostizieren, um den Betroffenen eine wirksame Therapie anzubieten", ergänzt sie.
Die Erkenntnisse aus dieser Forschung werden neben dem Verständnis für Autoinflammatorische Erkrankungen auch dazu beitragen, Neurodegenerative- und Tumorerkrankungen besser zu verstehen, da auch hier die Funktionsfähigkeit des Proteasoms eine große Rolle spielt. (eb)