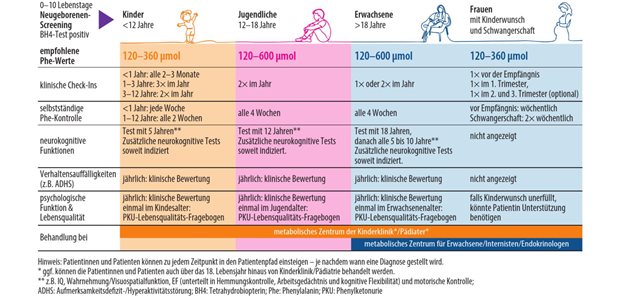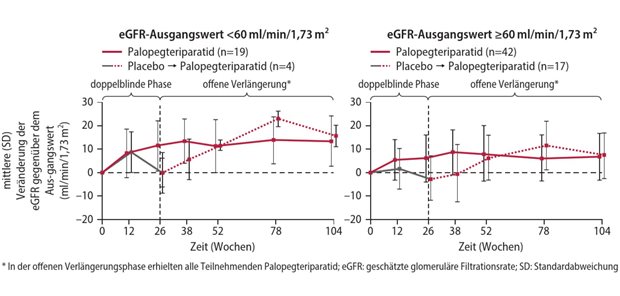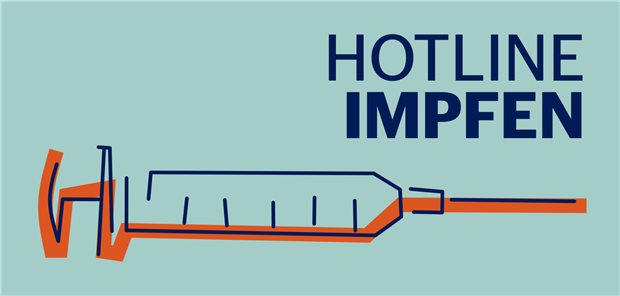Seltene Erkrankungen
EU-Forschungspartnerschaft ERDERA adressiert molekulare Diagnostik Seltener Erkrankungen
Das auf sieben Jahre angelegte EU-Forschungsprojekt ERDERA soll zu einer besseren Versorgung der rund 30 Millionen Menschen mit Seltenen Erkrankungen in Europa beitragen.
Veröffentlicht:Ivry-sur-Seine/Tübingen. Zu Monatsbeginn ist der Startschuss für die EU-Forschungspartnerschaft ERDERA (European Rare Diseases Research Alliance) gefallen. Ziel ist, die Gesundheit und das Wohlergehen der 30 Millionen Menschen, die in Europa mit einer seltenen Erkrankung (SE) leben, durch bessere Prävention, Diagnose und Therapiemöglichkeiten zu verbessern.
Das Programm ist auf sieben Jahre angelegt und hat insgesamt ein Budget von 360 Millionen Euro. Koordiniert wird die Partnerschaft von INSERM, dem französischen Nationalen Institut für Gesundheit und medizinische Forschung. Finanziert wird ERDERA gemeinsam durch die EU aus Mitteln von Horizont Europa, dem Europäischen Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, und die jeweiligen Partnerländer.
Wie es in einer Mitteilung des Universitätsklinikums Tübingen, das an dem Projekt beteiligt ist, am Montag hieß, beträfen 7.000 bekannte SE mehr als 300 Million Menschen weltweit – 30 Million davon in Europa. Für 95 Prozent der Erkrankten gebe es keine Therapieoptionen, und rund 50 Prozent aller Betroffenen hätten bisher keine gesicherte molekulare Diagnose. ERDERA bringe nun alle relevanten Stakeholder aus dem SE-Bereich zusammen. Für die ersten drei Jahre sind über 140 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt 175 Institutionen aus 37 Ländern seien an ERDERA beteiligt.
Aus Tübingen seien das Zentrum für Seltene Erkrankungen und das Institut für Medizinische Genetik und Angewandte Genomik dabei, das unter dem ERDERA-Dach die diagnostische Forschung leite. Das Hertie Institut für klinische Hirnforschung werde substanziell zur Entwicklung von neuen Studienendpunkten (Outcomes) und statistischen Analysemodellen beitragen, die für die Messung von Therapieeffekten benötigt würden. Der besondere methodische Fokus liege hier auf kleinsten Fallzahlen, wie sie bei SE zumeist vorlägen. (eb)