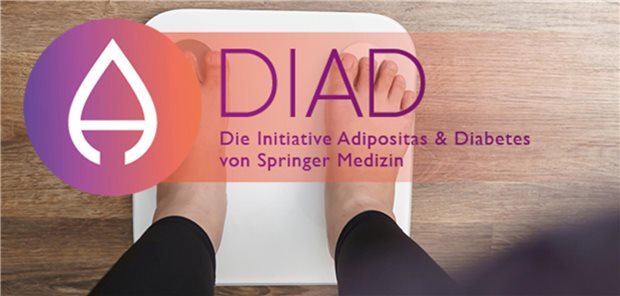Fetuin-A: ein Marker für das Diabetes-Risiko?
Bei nichtalkoholischer Fettleber produzieren die Leberzellen mehr Fetuin-A. Je höher der Spiegel dieses Eiweißes im Blut ist, desto ausgeprägter ist die Insulinresistenz.
Veröffentlicht:
Bei bis zu 70 Prozent der Typ-2-Diabetiker kann sonografisch eine Fettleber diagnostiziert werden.
© CoverSpot / imago
WIESBADEN (eb). Weder zu hoher Body-Mass-Index (BMI) noch Bauchansatz sind allein Grund dafür, dass Übergewichtige an Diabetes mellitus Typ 2 erkranken. Vor allem die Ansammlung von Fett in der Leber begünstigt die Störung des Blutzuckerstoffwechsels.
Welche Patienten gefährdet sind, könnte künftig ein Bluttest zeigen, an dem Tübinger Forscher arbeiten. Ungesunde Ernährung führt bei vielen Menschen dazu, dass sich Fett in der Leber ansammelt.
"Wir gehen davon aus, dass es zu krankhaften Veränderungen kommt, wenn der Fettgehalt der Leber über 5,5 Prozent liegt", berichtet Professor Norbert Stefan von der Universität Tübingen in einer Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) vorab zum Internistenkongress vom 30. April bis 3. Mai in Wiesbaden.
Dort werden Experten über neue Erkenntnisse zur Fettleber diskutieren und Wege zur Vorbeugung eines Typ 2-Diabetes aufzeigen.
Im Tübinger Lebensstil Interventionsprogramm (TULIP) hat Stefan zusammen mit seinen Kollegen der Inneren Medizin IV und der Sektion für Experimentelle Radiologie bei mittlerweile mehr als 400 Menschen mit einem Risiko für Typ-2-Diabetes den Fettgehalt der Leber mit Kernspintomografie bestimmt. Jeder Dritte hatte eine nichtalkoholische Fettleber, auch NAFL genannt.
"Die Bedeutung von NAFL für Typ-2-Diabetes wurde lange übersehen", wird Stefan zitiert. NAFL und das fortgeschrittene Stadium NASH (nichtalkoholische Steatohepatitis) galten bisher eher als Begleiter, nicht aber als mögliche Ursachen des Diabetes. Die Ergebnisse der Tübinger Forscher zeigen jedoch, dass eine Fettleber den Blutzuckerstoffwechsel empfindlich stören kann.
Eine wichtige Bedeutung hat dabei das von der Leber gebildete Eiweiß Fetuin-A: "Im Tiermodell konnten wir zeigen, dass bei NAFL vermehrt Fetuin-A in den Leberzellen entsteht", erläutert der Experte. Fetuin-A wiederum vermindert die Wirkung des Blutzucker senkenden Hormons Insulin in den Zellen des Körpers - der Betroffene entwickelt eine Insulinresistenz.
Die Tübinger Forscher fanden heraus, dass die Konzentration von Fetuin-A im Blut eng mit der Insulinresistenz verbunden ist. Dadurch steigt der Blutzucker dauerhaft und ein Typ-2-Diabetes kann entstehen.
Zusammen mit Kollegen des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam zeigten sie, dass Menschen mit sehr hohem Fetuin-A-Blutwert ein um 75 Prozent erhöhtes Diabetes-Risiko haben.
Das Eiweiß hat weitere negative Auswirkungen: Es ruft Entzündungsreaktionen im Körper hervor und schädigt dadurch die Blutgefäße: Menschen mit einem hohen Fetuin-A-Blutwert haben nach Erkenntnissen der Tübinger und Potsdamer Wissenschaftler ein 3,3-fach erhöhtes Herzinfarkt- und ein 3,8-fach erhöhtes Schlaganfallrisiko.
"Dieser Fettleber-Marker erlaubt Vorhersagen zum Diabetes-, Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko und möglicherweise auch die Kontrolle des Therapieerfolgs", so Stefan.
Auch ein anderer Signalstoff aus der Leber spielt dabei eine Rolle: Das "Sex Hormone-Binding Globulin" (SHBG), ein Transporter für Geschlechtshormone im Blut. SHBG schützt vor Diabetes.
Die Untersuchungen der Tübinger Forscher zeigen, dass eine Fettleber weniger SHBG bildet. Sie untersuchen derzeit intensiv die Regulation des SHBG-Spiegels und wie das Hormon in den Blutzuckerstoffwechsel eingreift.
Terminhinweis: Meet the Expert: NASH - Marker für metabolisches und kardiovaskuläres Risiko; Referent: Professor Norbert Stefan, Tübingen; Montag, 2. Mai, 18.00 bis 18.45 Uhr, Saal 1A/2, Rhein-Main-Hallen; www.dgim2011.de