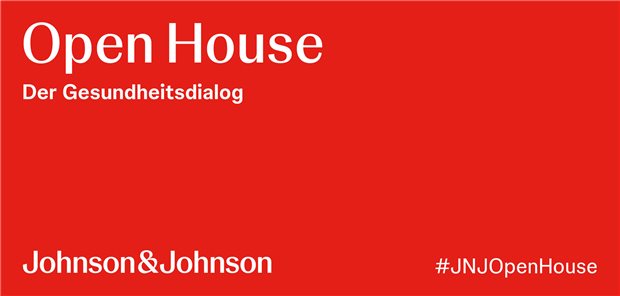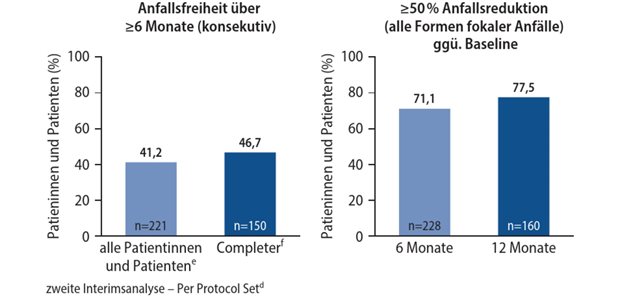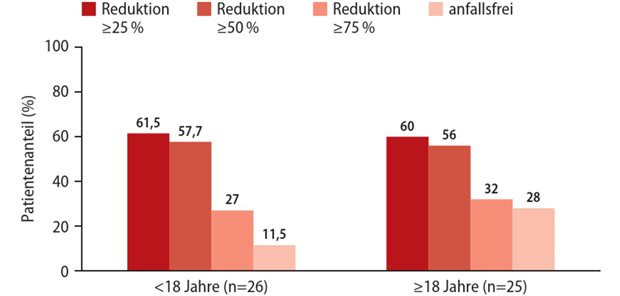Hürden in der Forschung
Gehen den Psychiatern bald die Pillen aus?
Mit neuen Arzneien gegen psychische Störungen tut sich die Industrie derzeit schwer. Das Problem: komplexe Krankheiten, schwierige Patienten und rechtliche Hürden. Und auch ertrinkende Mäuse im Wasserglas bringen die Forscher nicht weiter. Aber es gibt Auswege.
Veröffentlicht:
Maus im Labor: Manche Versuche für neue Pharmaka sorgen bei Forschern für Kopfschütteln.
© Jochen Tack / imago
BERLIN. Psychiater haben ihren Patienten vielleicht bald nichts mehr Neues anzubieten, zumindest nicht bei der Arzneitherapie. Ungeachtet der Tatsache, dass etwa jeder Dritte in Deutschland mindestens einmal im Jahr mit einer psychischen Störung zu kämpfen hat, sprudeln in diesem Bereich nicht gerade die pharmakologischen Innovationen.
Das Problem zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen ziehen sich immer mehr Unternehmen aus der Psychopharmaka-Forschung zurück: 2010 gab GlaxoSmithKline die Indikationen Schmerz, Depression und Angst auf - zwei Neuroscience-Center wurden geschlossen.
Im selben Jahr beendete AstraZeneca die Neuentwicklung von Medikamenten gegen Schizophrenie, bipolare Störungen, Depression und Angst. Auch hier wurde die Schließung von Forschungsstätten in den USA und Europa angekündigt.
Und erst vor kurzem hat das Unternehmen Bristol-Myers Squibb verlautbart, seine Forschung im gesamten ZNS-Bereich weitgehend einzustellen. Die europäische Neuropharmakologen-Gesellschaft ECNP hat daher schon vor zwei Jahren Alarm geschlagen und davor gewarnt, dass der Rückzug der Industrie die Entwicklung besserer Psychopharmaka gefährdet.
"Viele der Firmen investieren stattdessen in Bereiche wie Onkologie", sagte Dr. Siegfried Throm, Geschäftsführer für den Bereich Forschung und Entwicklung beim Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa) beim DGPPN-Kongress Ende November in Berlin.
Friedhofstimmung bei Antidepressiva-Entwicklern
Genau das lässt sich mittlerweile auch beobachten: 33 Prozent aller fortgeschrittenen Projekte laufen nach Angaben des vfa im Bereich Onkologie, nur fünf Prozent der neuen Medikamente werden derzeit gegen psychische Erkrankungen entwickelt, "obwohl das eigentlich ein lukrativer Markt ist", so Throm mit Blick auf die Häufigkeit von psychischen Störungen und den hohen medizinischen Bedarf.
Allerdings ist es auch ein riskanter Markt für Neuentwicklungen: Allein in diesem Jahr sind bereits fünf neue Antidepressiva in Phase-II- und Phase-III-Studien mangels Wirksamkeit gescheitert, bei neuen Antipsychotika sieht es nicht viel besser aus.
"Hier tut sich ein wahrer Friedhof auf", sagte der vfa-Geschäftsführer. In den vergangenen Jahren sei die Erfolgsquote bei der Entwicklung neuer Psychopharmaka stetig gesunken. Derzeit schaffen es nur etwa acht Prozent der Wirkstoffe, die sich bereits in klinischen Studien befinden, bis zur Zulassung.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen mangelt es an geeigneten präklinischen Modellen. So werden neue Substanzen bei Mäusen auf antidepressive Effekte getestet, indem man die Tiere in ein Becherglas mit Wasser wirft.
Die Forscher stoppen die Zeit, bis die Tiere ihre Schwimmversuche aufgeben und sich dem scheinbar unvermeidlichen Tod durch Ertrinken hingeben - je länger ihnen das gelingt, umso stärker scheint die antidepressive Wirkung der Substanz zu sein.
Dieses Konzept wurde auf dem Kongress nicht zuletzt von Professor Florian Holsboer vom Max-Planck-Institut in München als völlig unzureichend und absurd bezeichnet.
Zwar erhöhen viele Antidepressiva in der Tat die Motivation der Nager, in ihrer Todesangst noch etwas länger zu paddeln, als sie es normalerweise tun, man könne umgekehrt aber nicht daraus schließen, dass Substanzen, die hier keine Wirkung zeigten, nicht antidepressiv sind.
"Wegen diesem blöden Test, der mit Depression gar nichts zu tun hat, sind vermutlich unzählige geeignete Substanzen in die Binsen gegangen", sagte Holsboer.
Subjektive Endpunkte, hoher Placeboeffekt
Ein anderes Problem sind fehlende Biomarker und Targets: In der Onkologie werden nach Darstellung der vfa bereits bei 37 Prozent der Studien Biomarker verwendet, die Auskunft über den Therapieerfolg liefern, in der Psychiatrie gerade einmal bei 14 Prozent.
Hinzu kommt, dass der Therapieerfolg oft schwer zu beurteilen ist. Während in der Onkologie recht einfach und zweifelsfrei zu ermitteln ist, ob ein Patient noch lebt oder rezidivfrei ist, beruhen die Studienendpunkte in der Psychiatrie oft auf sehr subjektiven Angaben und willkürlichen Cut-off-Werten für Ansprech- und Remissionsraten.
Hinzu kommt ein ausgeprägter Placeboeffekt - auch der entfällt in der Onkologie meist. Als Konsequenz, so Throm, sind in der Psychiatrie relativ große Patientenzahlen nötig, um signifikante Unterschiede nachzuweisen.
Schwierigkeiten bereitet auch die schlechte Therapieadhärenz: Gerade bei Antipsychotika gelingt es den wenigsten Patienten, die Mittel über längere Zeit einzunehmen.
Es treten aber auch pharmakologische Hindernisse auf: Psychiatrische Arzneien müssen in der Lage sein, die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Und aus der Tatsache, dass ein Großteil der ZNS-Wirkstoffe über das Cytochrom-P450-System metabolisiert wird, resultieren zahlreiche Wechselwirkungen.
Aus all diesen Gründen, so Throm dauert die klinische Entwicklung eines neuen ZNS-Präparates im Schnitt achteinhalb Jahre und damit 40 Prozent länger als bei anderen Indikationen, das Zulassungsverfahren benötige etwa 13 Prozent mehr Zeit. 1
Erhält ein Medikament dann endlich die Zulassung von der FDA oder EMA, folgt als Nächstes die Nutzenbewertung über nationale Institutionen wie das NICE oder IQWiG/GBA. Laut Throm stehen hier oft Mortalität und Morbidität an erster Stelle, damit könne man bei Therapien gegen psychische Störungen aber oft nur wenig Punkten.
Verbesserungen der Lebensqualität, wie sie bei chronischen psychischen Erkrankungen angestrebt werden, hätten bei der Nutzenbewertung eher einen geringen Stellenwert, folglich würden auch weniger Nebenwirkungen akzeptiert. Ein generelles Problem sei zudem, dass jedes Land seine eigenen Kriterien zur Nutzenbewertung hat, was einen erheblichen Aufwand verursache.
Dass solche Hürden nicht gerade förderlich für die Entwicklung neuer ZNS-Medikamente sind, kann auch Dr. Perry De Jongh, Medizinischer Direktor bei Lundbeck in Hamburg, bestätigen.
Das Unternehmen setzt trotzdem ausschließlich auf den ZNS-Bereich und will im ersten Halbjahr 2014 mit Nalmefene (Alkoholabhängigkeit), Vortioxetin (Depression) und einem Aripirazol-Depotpräparat (Schizophrenie) drei neue Medikamente gegen psychische Erkrankungen einführen.
De Jongh verwies beim Kongress darauf, wie wichtig das Wachstum des Pharmamarktes für Neuentwicklungen ist. In der Regel könne ein Unternehmen kaum mehr als 20 Prozent des Umsatzes für Forschung und Entwicklung ausgegeben.
Gibt es nicht genug Wachstum, und steigen zugleich durch zahlreiche Hürden die Anforderungen und Kosten der Medikamentenentwicklung, dann geraten die Unternehmen unter Druck, die Investitionen in Forschung und Entwicklung wieder einzuspielen. Dies sei einer der Gründe, weshalb viele Firmen nach einigen Fehlschlägen aus dem schwierigen ZNS-Bereich aussteigen.
Noch wachse zwar der Pharmamarkt - vor allem in den USA und den Schwellenländern, dennoch gestalte sich die lange Entwicklungszeit zu einem Problem: Der Patentschutz von 20 Jahren beginnt in der Regel schon vor der klinischen Entwicklung.
Er läuft dann mitunter schon ab, bevor sich das Produkt amortisiert hat. Die Kosten für die Entwicklung eines neuen Arzneimittels bis zur Markteinführung schätzt De Jongh derzeit auf etwa eine Milliarde Euro.
Personalisierte Medizin als Ausweg?
Der Psychiater Florian Holsboer will strukturelle und politische Probleme jedoch nicht als einzige Gründe für die missliche Lage bei der Arzneimittelentwicklung gelten lassen, er sieht auch Versäumnisse der pharmazeutischen Industrie.
Pharmafirmen seien noch zu sehr auf die Suche nach Blockbustern fixiert. Gesucht würden neue Antidepressiva, die bei möglichst allen Depressiven wirken. Dazu seien die Patienten aber zu heterogen.
Die heutigen breit wirksamen monoaminergen Antidepressiva zeigten immer noch recht bescheidene Ansprechraten von etwa 50 Prozent bei zum Teil deutlichen Nebenwirkungen.
Bei der klinischen Wirksamkeit, so Holsboer, habe es in den vergangenen Jahren keine Verbesserungen gegeben, allenfalls etwa bei der Verträglichkeit. "Warum sollte also ein Arzt ein neues Antidepressivum verschreiben, das fünfmal mehr kostet, aber nicht wesentlich mehr bringt als die bisherigen Mittel?"
Der Psychiater forderte die Unternehmen auf, neue Wege zu beschreiten. Einen solchen sieht er in der personalisierten Medizin. Unter der Diagnose Depression werden nach seiner Ansicht eine ganze Reihe verschiedener Krankheitsbilder zusammengefasst: Der eine Depressive ist antriebsgehemmt, schläft und isst sehr viel, der andere ist antriebsgesteigert, schläft und isst wenig.
Es liege nahe, dass nicht beide auf dieselbe Therapie ansprechen. "Nicht einmal Patienten mit demselben klinischen Bild sprechen in gleicher Weise auf eine bestimmte Medikation an", so Holsboer. Mit der One-size-fits-all-Strategie komme man hier nicht mehr weiter. "Wie müssen Untergruppen finden, unabhängig von dem, was wir oberflächlich sehen", sagte er.
Als Beispiel nannte der Psychiater die Stressregulation, die bei vielen Depressiven aus dem Lot geraten ist und sich in einer übermäßigen Aktivität von Corticotropin Releasing Hormon (CRH) und Vasopressin zeigt. Eigentlich müsste sich dieser Prozess über einen CRH-Rezeptor-Antagonisten blockieren lassen.
Solche Antagonisten sind inzwischen von fast allen großen Pharmafirmen klinisch geprüft worden - und allesamt gescheitert. Das Problem, so Holsboer: Nur bei einem Teil der Patienten lassen sich im Liquor tatsächlich außergewöhnlich hohe CRH-Werte nachweisen, und eigentlich wären es nur diese Patienten, die überhaupt vom neuen Ansatz profitieren könnten.
Wenn jedoch alle Patienten den Antagonisten erhalten, auch solche ohne erhöhte CRH-Werte, dann sei es kein Wunder, dass sich unterm Strich keine Wirksamkeit nachweisen lasse. Auf diese Weise seien wohl schon viele interessante Ansätze verbrannt worden.
REM-Schlaf-Muster als Biomarker
Holsboer hält es daher für wichtig, geeignete Biomarker zu identifizieren, mit denen sich die jeweiligen Subgruppen unkompliziert nachweisen lassen.
So scheinen Patienten mit CRH-Überexpression spezifische REM-Schlaf-Muster zu zeigen. Damit könnte man möglicherweise Patienten für Studien mit den neuen CRH-Rezeptor-Antagonisten selektieren.
Doch wenn die Entwicklung neuer Medikamente so teuer ist, lohnt es sich dann überhaupt, Pillen speziell für Subgruppen von Patienten zu entwickeln? Hier sieht der Psychiater sogar mehr Chancen als Risiken. Werden Medikamente speziell auf bestimmte Patientengruppen zugeschnitten, dann sollten die Ansprechraten dort höher sein als mit den bisherigen Therapien.
Man bräuchte also deutlich weniger Patienten, um eine signifikante Wirksamkeit festzustellen, und das würde die Kosten der Entwicklung drastisch senken, da diese ja überwiegend in der klinischen Phase anfallen. Holsboer schätzt, das Pharmafirmen mit 200 bis 300 Millionen Euro für die Entwicklung einer personalisierte Arznei auskommen würden - also einem Drittel bis einem Fünftel der bisher üblichen Entwicklungskosten.
Sollten diese Medikamente bei den jeweiligen Patienten dann tatsächlich deutlich wirksamer sein, würde dies nicht nur die Akzeptanz bei Ärzten und Patienten erhöhen, sondern auch bei den Institutionen zur Nutzenbewertung.
Immerhin wird in dieser Richtung jetzt einiges unternommen: Bei Forschungsprojekten der "Innovative Medicine Initiative (IMI)" 2 der EU ziehen kleinere und größere Biomedizin- und Pharmafirmen sowie Universitäten und Patientenorganisationen an einem Strang, um neue Biomarker für Schizophrenie und Depression zu identifizieren.
Die Marker sollen helfen, die Krankheiten besser zu charakterisieren und anschließend gezielte Therapien zu entwickeln. Vielleicht sehen wir in naher Zukunft doch nicht das Ende der Psychopharmakologie, sondern einen vielversprechenden Neubeginn.