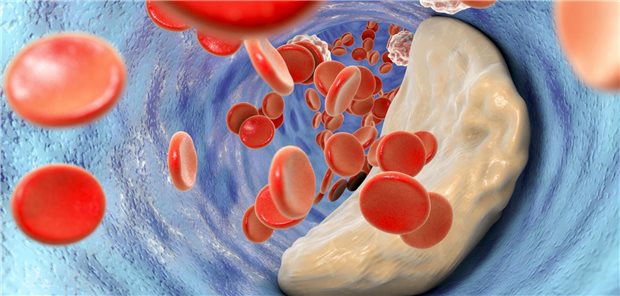Robert-Koch-Medaille in Gold
Hohe Auszeichnung für Infektionsbiologen
Für sein Lebenswerk wird Professor Thomas Meyer vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin (MPIIB) ausgezeichnet. Er erhält die Robert-Koch-Medaille in Gold vor allem für seine Arbeiten zur molekularen Infektionsbiologie.
Veröffentlicht: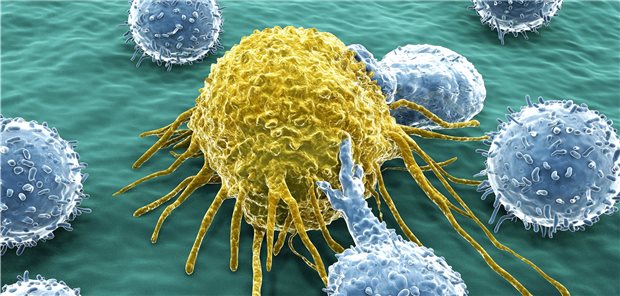
Immunzellen attackieren eine Krebszelle: Professor Thomas Meyer erforscht auch den Zusammenhang zwischen Infektion und Krebsentstehung.
© Juan Gärtner / stock.adobe.com
Berlin. Die Robert-Koch-Stiftung ehrt Professor Thomas Meyer vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin (MPIIB) mit der Robert-Koch-Medaille in Gold. Die Auszeichnung soll bei einem Festakt am 13. November in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin überreicht werden.
Mit Meyer werde ein Wissenschaftler geehrt, der in seinem Fach wie kaum ein anderer einen Erfahrungsschatz angesammelt hat und für richtungsweisende Infektionsforschung steht, würdigt die Robert-Koch-Stiftung den Forscher in einer Mitteilung.
Der Infektionsbiologe sei immer wieder seiner Zeit weit voraus gewesen und setze bis heute Meilensteine in der Infektionsforschung bis hin zur Aufdeckung ursächlicher Mechanismen der Krebsentstehung.
Viele seiner Entdeckungen sind heute Lehrbuchwissen

Professor Thomas Meyer vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie.
© Privat
Wichtige Erkenntnisse erzielte er auch zu den Fragen, wie die Erreger „Angriffswaffen“ an ihre Oberfläche transportieren, um damit die Zellen ihres Wirtsorganismus umzuprogrammieren, wie sie gegenseitig Gene austauschen, um sich damit aufzurüsten, und wie sie erfolgreich in Wirtszellen eindringen, um sich darin zu vermehren.
Viele dieser frühen Entdeckungen aus Meyers Labor sind inzwischen Lehrbuchwissen und bildeten die Grundlage für ähnliche Beobachtungen bei einer Vielzahl von Erregern. Im Rückblick wird deutlich, wie systematisch und konsequent der Forscher bei seinen Analysen vorgegangen ist.
Konzept der „wirtsgerichteten“ Therapie
Mit der Erkenntnis, dass eine Infektion immer von zwei Faktoren abhängt, dem Erreger und seinem Wirt, formulierte der Forscher bereits früh die provokante Hypothese, dass man Infektionserreger auch durch eine Blockade in menschlichen Zellen und nicht nur wie bisher durch Antibiotika oder antivirale Substanzen ausschalten könne.
In seinen Folgearbeiten befasste sich Meyer daher mit der Rolle von Wirtskomponenten bei Infektionsvorgängen und beteiligte sich maßgeblich an der Entwicklung des Konzepts der „wirtsgerichteten“ Therapie. Sie bildet mittlerweile neben dem Einsatz von Impfstoffen und Antibiotika eine moderne dritte Säule der Erregerbekämpfung – insbesondere auch, weil man damit Resistenzentwicklungen verhindern kann. Zudem gelingt es damit, altbewährte Medikamente für andere Erkrankungen, beispielsweise Krebs, sehr rasch gegen Infektionen neu auszurichten.
Beweis für die Rolle von Erregern bei Krebsentstehung
Die Frage nach dem Schicksal von Wirtszellen, die eine Infektion durchlaufen haben, schloss sich nahtlos an diese Untersuchungen an: Werden menschliche Zellen bei einer Infektion vielleicht geschädigt und verursachen dann aufgrund ihrer Defekte weitere Krankheiten im Körper? Von Helicobacter pylori etwa ist bekannt, dass das Bakterium nicht nur Geschwüre, sondern auf lange Sicht auch Magenkrebs auslösen kann.
Meyer sucht nun nach einem Fingerabdruck, einer genetischen Signatur, um den Beweis für einen Zusammenhang zwischen Infektion und Krebsentstehung erbringen zu können. Tatsächlich untermauern seine jüngsten Forschungsergebnisse nicht nur die Bedeutung von Helicobacter bei der Entstehung von Magenkrebs, sie beleuchten auch die Wirkung gewisser Darmbakterien, die das menschliche Erbgut mit einem Genotoxin schädigen.
Wie Meyer herausfand, verursacht ein Toxin von Escherichia coli, das „Colibactin“, ein bestimmtes Muster von Mutationen im menschlichen Darm, das Jahre später in den Zellen einer Gruppe von Darmkrebspatienten wiedergefunden wird – erstmals ein klarer Beweis für die Rolle des Erregers bei der Krebsentstehung im Menschen.
Organoide zur Infektionsforschung gezüchtet
Die Faszination daran, den Dingen auf den Grund zu gehen und dabei innovative Wege zu beschreiten, hat sich Meyer über Jahrzehnte hinweg bewahrt. Bereits in den 1990er Jahren hatte er damit begonnen, organähnliche Strukturen heranzuzüchten, um Infektionsprozesse wie auch die Entstehung von Krebszellen in vitro besser zu verstehen.
Inzwischen wurden solche „Organoide“ aus Epithelzellen des Magens, des Ovidukts, der Zervix, der Prostata, der Gallenblase sowie der Lunge in Meyers Team entwickelt. Letztere hatte er schon für Studien mit Influenza-Viren verwendet. Da diese menschlichen Lungenzellen den ACE-2 Rezeptor ausprägen, der SARS-CoV-2 als Eintrittspforte dient, verwendet sie Meyer nun zur Testung händeringend gesuchter Medikamente gegen COVID-19 als Ersatz für aufwändige Tierversuche. Wieder einmal liegt der Forscher damit absolut am Puls der Zeit.
Die Anerkennung für Meyers großes Lebenswerk spiegelt sich in seinen vielen wichtigen Publikationen und renommierten Preisen wider, darunter die Otto Hahn Medaille der Max-Planck-Gesellschaft (1981), der Heinz-Maier-Leibnitz-Preis des Bundesministeriums für Wissenschaft und Bildung (1986), der Hauptpreis der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (1989), der Max-Planck-Forschungspreis (1993) und der Aronson-Preis des Landes Berlin (1996).
Mit einer jüngst an ihn vergebenen Förderung des European Research Councils wird er seine zukunftsweisende Forschung zur Rolle von Infektionen bei der Krebsentstehung des Menschen in den kommenden Jahren fortführen können. (eb/eis)