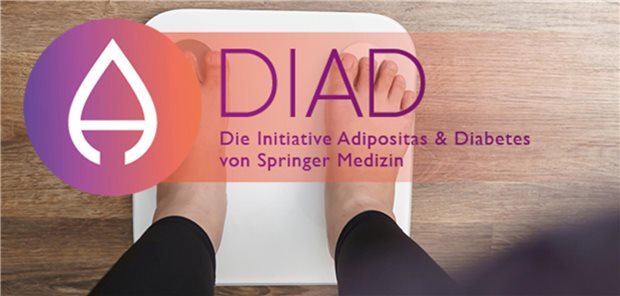Je fortgeschrittener das Fußsyndrom, desto häufiger sind resistente Keime
DÜSSELDORF (hbr). Bei Patienten mit diabetischem Fußsyndrom kommt es oft sekundär zur Infektion von Ulzera. Solche Infektionen erhöhen das Risiko für eine Amputation. Worauf ist zu achten?
Veröffentlicht:Das Keimspektrum beim diabetischen Fußsyndrom sei recht konstant, sagt Professor Walter Däubener von der Universität Düsseldorf: Gram-positive Erreger machen 60 bis 70 Prozent aus. Dazu kommen 20 bis 30 Prozent Gram-negative Stäbchen und fünf bis zehn Prozent Anaerobier. Pilze machen sich eher rar.
Bei frischem Ulkus überwiegt die Mono-Infektion, Haupterreger ist Staphylococcus aureus. Hier kommen zunächst Antibiotika in Betracht, die gut gegen Gram-positive Kokken wirken, etwa Penicilline plus Betalaktamase-Hemmer oder Cephalosporine. Ältere Ulzera beherbergen oft Gram-negative Stäbe und zu einem Drittel Mischinfektionen. Spätestens die Gangrän bringt auch anaerobe Bakterien ins Spiel.
Plädoyer für grundsätzlichen Abstrich vor der Therapie
Eine mikrobiologische Diagnostik ist spätestens ab Wagnerstadium 2 -also tiefes Ulkus bis zur Gelenkkapsel, Sehnen oder Knochen - wichtig. Dr. Gerd Friese vom Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) in Düsseldorf plädiert grundsätzlich für einen Abstrich vor Therapiebeginn. Däubners Institut fand bei 70 Prozent von 700 Wundabstrichen relevante Keime.
Staphylokokken, Streptokokken und Enterokokken stellten die Gram-positiven Erreger. Die Gram-negativen beinhalten Enterobakterien wie Proteus, Klebsiella und Escherichia coli sowie Pseudomonas. Der entscheidende Erreger sitzt dabei meist in der Tiefe der Wunde, betont Däubener bei der DDZ-Veranstaltung in Düsseldorf: Das ist wichtig, wenn man den Abstrich für die Diagnostik macht.
Der häufigste Erreger in Ulzera bleibt weiter Staphylococcus aureus, unterstrich er bei der nationalen Diabetesfortbildung für DMP-Ärzte. Der Keim wird zunehmend zum Problem. Denn er kommt auch in normaler Haut- und Schleimhautflora vor und findet sich in Nasopharyngealraum, Leisten- und Analregion. Und seit Jahren steigt der Anteil Methycillin-resistenter Staphylococcus- aureus-Keime (MRSA).
So werden MRSA heute in jedem vierten Staphylococcus-aureus-Isolat aus Kliniken nachgewiesen. Bei Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sogar in jedem zweiten Fall. Betalaktam-Antibiotika, etwa Cephalosporine, wirken bei ihnen nicht, auch nicht zusammen mit einem Betalaktamase-Hemmer. Eine Resistenz gegen Aminoglykoside und Gyrasehemmer kommt oft noch dazu. Zuverlässig wirksam sind aber Glykopeptid-Antibiotika wie Vancomycin, so Däubener.
Rifampicin und Fosfomycin brächten ebenfalls sehr gute Erfolge. Sie sollten aber nur kombiniert verwendet werden, weil bei Monotherapie sonst rasch Resistenzen entstehen können. Auch Linezolid kommt in Betracht, da bei MRSA keine Resistenzen beschrieben sind.
Vor kurzem wurde übrigens in Deutschland ein weiterer - noch relativ seltener - MRSA-Stamm entdeckt, der c-MRSA (c = community acquired). Er führt oft zu schwereren Krankheitsverläufen. Bei diesem Stamm wirken aber Aminoglykoside und Gyrasehemmer noch.
Mehr Infos zu Diabetes im Springer Lexikon Medizin, Essay der Professoren Eberhard Standl und Franz Rinninger, S. 481