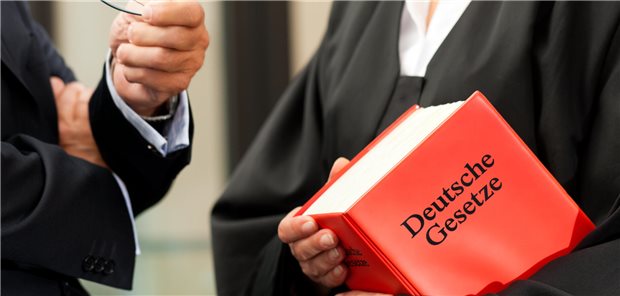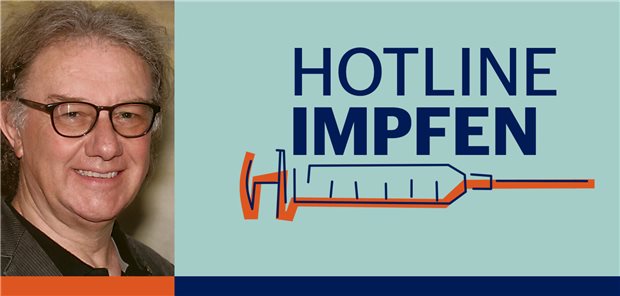Erste Tests vielversprechend
Neuartiges Antibiotikum entdeckt
Im Kampf gegen multiresistente Keime gibt es neue Hoffnung: Forscher haben ein neuartiges Antibiotikum entdeckt. Der Wirkstoff verursacht nach ersten Tests keine Resistenzen, wie die Wissenschaftler berichten.
Veröffentlicht:BONN. Forscher aus den USA, Großbritannien, des Universitätsklinikums Bonn und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) sind auf ein neuartiges Antibiotikum gestoßen, das nach ihrer Einschätzung über großes Potenzial verfügt (Nature 2015; 7. Januar).
Das neuartige Antibiotikum wird von einem Bodenbakterium produziert, dem die Forscher den Namen "Elefhtheria terrae" gegeben haben, und wird selbst als "Teixobactin" bezeichnet.
Für die Forscher ist Teixobactin ein vielversprechendes Antibiotikum, weil es gegen ein breites Spektrum von Krankheitserregern wirke und nach ersten Tests keine Resistenzen verursache, teilt die Uni Bonn zur Veröffentlichung der Studie mit.
"Wir könnten in eine Vor-Antibiotika-Ära zurück fallen, in der ohne neue Wirkstoffe bakterielle Infektionen nicht behandelbar sind. Die Resistenzen entwickeln sich deutlich schneller, als neue Antibiotika auf den Markt kommen", wird Privatdozentin Dr. Tanja Schneider zitiert.
Schneider leitet eine Nachwuchsgruppe des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn.
Allein an Infektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) sterben pro Jahr schätzungsweise rund 25.000 Menschen weltweit.
Mühsame Suche nach neuen Wirkstoffen
Pilze und Bakterien produzieren bekannterweise Hemmstoffe, um mit anderen Mikroorganismen zu konkurrieren - darunter können neuartige Antibiotika sein. Auf der Suche nach solchen neuen, bisher unbekannten Antibiotika-produzierenden Organismen durchkämmen Wissenschaftler Ozeansedimente, Böden und sogar Tierexkremente.
"Die Suche ist mühsam, denn die Erfolgsquote einen wirklich neuen Wirkstoff zu finden, ist äußerst gering", berichtet Schneider in der Mitteilung.
Darüber hinaus lassen sich nur etwa ein Prozent der dafür in Frage kommenden Bakterien und Pilze auf herkömmlichen Nährmedien für Analysen kultivieren.
Mit einem speziellen Kultivierungsverfahren gelang es der internationalen Forschergruppe, dem auch das Team um Schneider angehört, bislang unerforschte und unkultivierbare Bodenbakterien im Labor zu isolieren, berichtet die Uni Bonn in ihrer Mitteilung.
Mit Screening-Verfahren hätten sie dann die gesuchte "Nadel im Heuhaufen" gefunden: Eines der unbekannten Bakterien produziert eine Substanz, die sich gegen ein weites Spektrum häufiger Gram-positiver Erreger als sehr wirksam erwies. Die Wissenschaftler nannten das Bakterium "Elefhtheria terrae" und das von ihm produzierte Antibiotikum "Teixobactin".
Weitere Tests ließen vermuten, dass es absehbar keine Resistenzen verursacht. "Es handelt sich um einen hochinteressanten Wirkstoff", sagt Schneider.
Angriff an der Achillesferse der Erreger
Die Wissenschaftler des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Uniklinikums Bonn, die auch zum Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) gehören, entschlüsselten nun den Wirkmechanismus des neuen Bakterienhemmstoffs.
"Teixobactin setzt an der Achillesferse vieler Krankheitserreger an: Es hemmt die Synthese der Bakterienzellwand", wird Doktorandin Ina Engels in der Mitteilung zitiert.
Auch andere Antibiotika, etwa Vancomycin, verhindern ja den Aufbau der Bakterienwand. Allerdings blockieren diese Wirkstoffe die Synthese der schützenden Umhüllung an einem Angriffspunkt - es trifft wie eine einzelne Gewehrkugel. Teixobactin dagegen wirke wie ein Schrotschuss und attackiere an vielen Punkten den Harnisch der Bakterien.
Das erkläre auch, weshalb das neuartige Antibiotikum vermutlich keine Resistenzen verursacht: "Teixobactin greift an vielen entscheidenden Stellen in den Aufbau der Zellwand an und macht bakterielle Anpassungsstrategien nahezu unmöglich", sagt Schneider.
Das Bakteriengift hat sich als sehr effektiv erwiesen, berichtet die Uni Bonn. Doch lässt es sich auch beim Menschen einsetzen? Erste Untersuchungen an Mäusen hätten ergeben, dass Teixobactin ein vielversprechender Kandidat sei. "
Antibiotika mit neuem Wirkmechanismus sind ein Durchbruch für die Forschung", so Schneider. Doch Verträglichkeit und Wirksamkeit beim Menschen müssen für Teixobactin erst noch in klinischen Tests erwiesen werden. (eb)