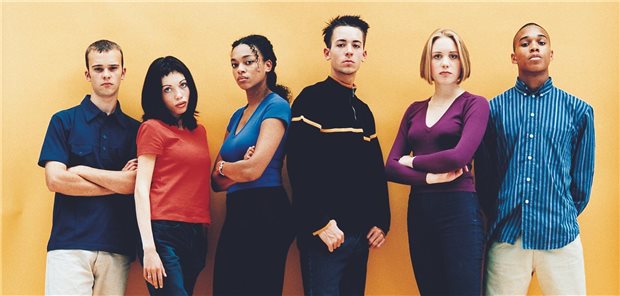Angst-Störungen
Ohne endogene Opioide wächst die Angst
Die Blockade der Opioid-Rezeptoren verstärkt das Lernen von Angstreaktionen, so eine Studie.
Veröffentlicht:HAMBURG. Angsterkrankungen entstehen nicht nur durch eigene traumatische Erfahrungen, sondern werden oft durch Beobachten traumatischer Erfahrungen anderer Menschen erlernt. Wenn Menschen dabei durch Beobachten von Schmerzen Anderer lernen, spielen offenbar endogene Opioide eine wichtige Rolle, berichten Forscher um Dr. Jan Haaker vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Nature Communications 2017; online; 25. Mai). Durch die Erforschung solcher beteiligter Substanzen "können wir in Zukunft vielleicht bessere Behandlungsmethoden entwickeln", wird der Forscher vom Institut für Systemische Neurowissenschaften am UKE in einer Mitteilung des Klinikums zitiert.
Für eine Studie hat das Team 43 Probanden untersucht. Bei 22 wurden die Opioid-Rezeptoren im Gehirn mit Naltrexon blockiert. 21 Kontrollpersonen bekamen hingegen ein Placebo. Allen Probanden wurden dann verschiedene Videos gezeigt. In manchen dieser Filme löste das Erscheinen von blauen Quadraten bei Menschen augenscheinlich starke Schmerzen aus. Mit diesen vermeintlichen Gefahren wurden die Probanden nach der Phase des beobachteten Lernens erneut konfrontiert. Die Forscher untersuchten dabei ihre Hirnaktivität mit funktioneller Kernspintomographie (fMRT).
Ergebnis: Werden die Opioid-Rezeptoren während der Lernphase blockiert, reagieren die Versuchsteilnehmer stärker auf den Schmerz anderer Menschen. "Sie zeigen dann auch in Hirnarealen, die für die Regulation von Schmerzen und Bedrohungen zuständig sind, eine stärkere Durchblutungsänderung", so Haaker in der Mitteilung. "Diese Personen haben also das Warnsignal besser gelernt, das den Schmerz bei anderen Menschen voraussagt." Der Effekt hält länger an, wie eine Nachuntersuchung drei Tage später ergab: Beim Betrachten der vermeintlich gefährlichen blauen Quadrate reagierten diese Probanden mit vermehrter Schweißproduktion – und bekamen feuchte Hände. (eb)