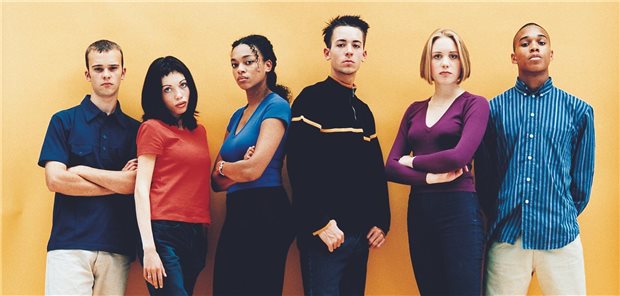Der Standpunkt
Vernachlässigte Hirnkrankheiten
Der Autor ist Redakteur bei Springer Medizin. Schreiben Sie ihm:thomas.mueller@springer.com
Wir stehen am Beginn eines Jahrhunderts der neuropsychiatrischen Erkrankungen, und es sieht derzeit nicht so aus, als ob das Gesundheitssystem gut darauf vorbereitet ist. Im Jahr 2030 werden Prognosen zufolge mit Depressionen, Demenz und Alkoholsucht drei der vier wichtigsten Krankheiten, welche die Lebensqualität und -dauer einschränken, Erkrankungen des Gehirns sein.
Wir können zwar immer besser Patienten mit Herz- und Krebserkrankungen behandeln, gegen die Neurodegeneration haben wir aber kein Mittel, und auch bei psychisch Kranken lässt sich ein chronischer Verlauf oft nur schwer verhindern.
Für die Sozialsysteme wird dies immer bedeutsamer: Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen sind mit Abstand der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung - inzwischen dreimal so häufig wie noch vor 25 Jahren, Depressionen sind gar die Krankheiten, die schon jetzt die meisten gesunden Lebensjahre kosten.
Wer nun hofft, dass sich die Versorgungsstrukturen auf diese Verhältnisse einstellen, hat sich aber getäuscht: Die Zahl der neuropsychiatrischen Vertragsärzte ist sogar tendenziell rückläufig, in Kliniken fehlen Neurologen, und in der ambulanten Psychiatrie werden falsche Anreize gesetzt.
Psychiater und Nervenärzte kritisieren, dass sich immer mehr junge Ärzte aus ihrem Fach auf Psychotherapie festlegen, weil sie sich davon eine deutlich besserer Honorierung versprechen als bei einer psychiatrischen Behandlung; zudem könnten sie sich dann auf die leichter kranken, kooperativen Patienten konzentrieren.
Dadurch besteht die Gefahr, dass die schwer und chronisch Kranken zunehmend durchs Raster fallen und häufiger in der Klinik landen. Auch das ist eine Interpretationsmöglichkeit für den deutlichen Anstieg von stationären psychiatrischen Behandlungen, wie er jetzt in Nordrhein-Westfalen dokumentiert wurde.
Es wird also höchste Zeit, die richtigen Anreize für eine Versorgung zu setzen, die auch in Zukunft funktioniert.