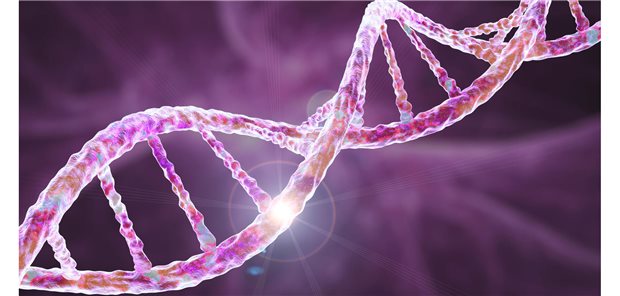Demenzgefahr
Viel Stress lässt womöglich Hirn schrumpfen
Haben gestresste Menschen eine höhere Demenzgefahr? Eine neue Studie offenbart: Bei Menschen im mittleren Alter, die einen hohen Spiegel des Stresshormons Cortisol aufweisen, ist das Gehirn kleiner und arbeitet schlechter als bei Gesunden. Frauen sind offenbar besonders anfällig.
Veröffentlicht:
Viel Cortisol, schlechtes Gedächtnis – das ist eine der Erkenntnis aus der Studie.
© Andrea Danti / stock.adobe.com
Das Wichtigste in Kürze
Frage: Wie hängen Cortisolspiegel, Kognition und Hirnvolumen im mittleren Lebensalter zusammen?
Antwort: Hohe Cortisolspiegel gehen mit einer verminderten Hirnleistung und einem reduzierten Großhirnvolumen einher.
Bedeutung: Möglicherweise erhöht viel Cortisol das Demenzrisiko
Einschränkung: Daten beruhen lediglich auf einer Querschnittsanalyse.
BOSTON. Die Folgen eines chronischen Cortisolüberschusses lassen sich besonders gut bei Patienten mit Cushing-Syndrom ablesen: Diese sind in der Regel stark übergewichtig, hyperton und überzuckert, auch leiden sie häufig unter Depressionen und Gedächtnisstörungen.
Letztere gehen mit strukturellen Veränderungen im Hippocampus und limbischen System einher – entsprechende Hirnstrukturen sind oft unterdurchschnittlich groß.
Ähnlich ungünstige kardiometabolische Effekte werden hohen Cortisolspiegeln infolge von chronischem Stress oder Insomnie nachgesagt, weniger klar ist jedoch, ob auch das Gehirn darunter leidet.
Studien zu dem Thema hätten bislang bevorzugt ältere Menschen einbezogen und Begleitfaktoren wie eine beginnende Demenz nicht gründlich ausgeschlossen, schreiben Neurologen um Dr. Justin Echouffo-Tcheugui von der Harvard Medical School in Boston. Auch habe man strukturelle Untersuchungen meist auf das limbische System beschränkt.
Kortikoidrezeptoren werden jedoch im gesamten Gehirn exprimiert, daher lohne es sich, auch andere Hirnareale unterm MR-Tomografen zu analysieren.
Viel Cortisol, schlechtes Gedächtnis
Das Team um Echouffo-Tcheugui hat nun genau das bei der dritten Generation von Teilnehmern der Framingham-Studie getan (Neurology 2018; online 24. Oktober).
Sie konnten Daten von über 2200 Personen im Alter von durchschnittlich 49 Jahren auswerten, die sich morgens zwischen 7.30 und 9 Uhr Serumproben entnehmen ließen und einer Batterie von Kognitionstests sowie einer strukturellen MRT-Bildgebung unterzogen.
Anhand der Serumproben konnten die Forscher die Morgen-Cortisolspiegel analysieren. Sie gliederten die Teilnehmer ihrer Werte entsprechend in drei gleich große Gruppen. Die Gruppe mit mittleren Werten (10,8–15,8 Mikrogramm pro Deziliter) umfasste in etwa den Normbereich und diente als Referenz.
Wie sich zeigte, schnitten die Teilnehmer im Terzil mit den höchsten Cortisolwerten bei den Kognitionstests deutlich schlechter ab als die Referenzgruppe.
Nach Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Ausbildung und kardiovaskulären Risikofaktoren hatten Teilnehmer mit hohem Morgencortisol signifikant schlechtere Werte in einem globalen Kognitionstest (ß=-0,18), einem visuellen Organisationstest (ß=-0,08), einem Aufmerksamkeitstest (ß=-0,02) sowie zwei Gedächtnistests (ß=-0,20 und -0,34).
In zwei von drei weiteren Prüfungen schnitten Personen mit hohen Cortisolwerten tendenziell, aber nicht signifikant schlechter ab. Die Effekte waren vor allem bei Trägern eines APOE4-Allels zu beobachten, das Geschlecht spielte keine Rolle.
In der Gruppe mit den niedrigsten Cortisolwerten gab es hingegen bei keinem einzigen Test statistisch belastbare Differenzen zur Referenzgruppe.
Mikrostrukturelle Schäden
In der MRT-Analyse offenbarte sich ebenfalls ein negativer Effekt in der Gruppe mit anfangs hohem Morgencortisol: Solche Menschen zeigten im Vergleich zur Referenzgruppe ein verringertes Großhirnvolumen; betroffen waren vor allem Parietal- und Frontallappen. Allerdings ergaben sich signifikante Differenzen nur für Frauen. Männer mit hohen Cortisolwerten hatten kein reduziertes Großhirnvolumen.
Beim Hippocampusvolumen sahen die Forscher weder für Frauen noch Männer Unterschiede in Abhängigkeit von den Kortisolspiegeln. Zudem hingen die beobachteten Hirnvolumenänderungen nicht vom APOE-Status ab.
Blickten die Wissenschaftler um Echouffo-Tcheugui auf die weiße Substanz, fanden sie bei Teilnehmern mit anfangs hohen Cortisolspiegeln eine reduzierte fraktionelle Anisotropie in vielen Bereichen, vor allem im Splenium und Corpus callosum. Dies deutet auf mikrostrukturelle Schäden der betroffenen Nervenfasern.
Wie genau hohe Cortisolwerte mit kognitiven Defiziten und hirnstrukturellen Veränderungen zusammenhängen, bleibt jedoch unklar. Ein Teil lässt sich wohl über kardiometabolische Veränderungen erklären.
Möglich ist aber auch, dass eine beschleunigte Hirnatrophie die Zahl der Kortikoidrezeptoren im Gehirn reduziert und damit eine Dysregulation der Hypophysen-Hypothalamus-Nebennieren-Achse bedingt, die wiederum zu erhöhten Cortisolspiegeln führt.
Ob die erhöhten Cortisolwerte Ursache oder Folge der Hirnveränderungen sind, lässt sich anhand der Daten folglich nicht unterscheiden, hierzu wären längere Kohortenstudien nötig.