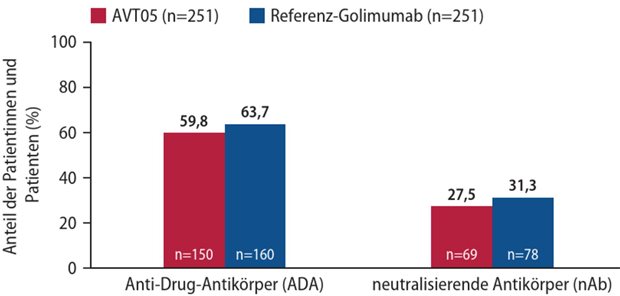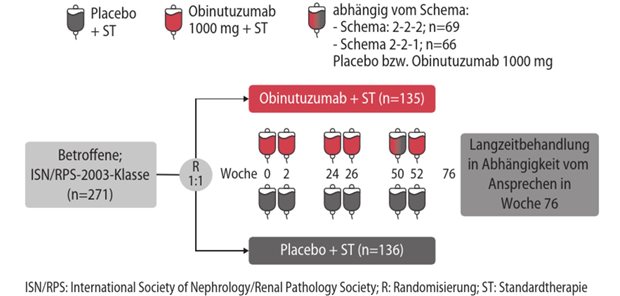Zur Seelenmassage in die Hausarztpraxis
TEMPLIN. Hausärzte sind bei psychischen oder psychosomatischen Problemen oft die ersten Ansprechpartner für die Betroffenen. Wie die Behandlung von Patienten mit Depressionen verbessert werden kann, darüber wird in den nächsten Tagen auch auf dem Ärztetag in Magdeburg diskutiert.
Veröffentlicht:In der Hausarztpraxis von Dr. Annekatrin Möwius im Brandenburgischen Templin eilt Praxisassistent Olrik Lischka von einem Behandlungszimmer zum nächsten. Auf den jungen Arzt wartet die etwa 65jährige Frau eines Krebspatienten. Ihr Mann weigert sich, die krampflösenden Medikamente zu nehmen, und er will nicht mehr zur Neurologin. Lischka nimmt sich Zeit, fragt nach dem Allgemeinbefinden.
"Sehr wechselhaft", sagt die Frau, "jetzt wo der Frühling da ist, wird er wieder etwas optimistischer." Der 34jährige Praxisassistent will wissen, ob das Ehepaar geklärt hat, wie es weiter geht, wenn der Betreuungsbedarf zunimmt. Dann sagt er: "Wir müssen auch an Sie denken. Ihr Mann hat nichts davon, wenn Sie zusammenbrechen." Die Frau nickt.
Wer Arbeit hat, ist krank, weil er zuviel arbeitet
"Die Ärzte an der Front kriegen die Zusammenhänge jeden Tag mit", sagt Chefarzt Dr. Bernd Sprenger von der Oberberg-Klinik Berlin-Brandenburg für Psychotherapie, Psychiatrie und psychosomatische Medizin. Mehr als drei Viertel der Hausärzte in Berlin und Brandenburg haben die Zulassung zur psychosomatischen Grundversorgung. Nötig ist das, meint Lischka. Sein Eindruck aus der Templiner Hausarztpraxis ist: "Wer hier Arbeit hat, ist krank, weil er zuviel arbeitet, und die anderen leiden darunter, daß sie keine Arbeit haben."
Die Statistiken geben dem jungen Arzt recht. Burnout und Depression nehmen bundesweit zu. Stetig steigt die Zahl der Menschen, die arbeitsunfähig sind, weil sie psychische Probleme haben. Die Statistik der häufigsten Gründe für Frühberentung wird seit 2003 von psychischen und psychosomatischen Krankheiten angeführt.
"Unsere Gesellschaft ist in seelischer Not", sagt deshalb die Psychosomatikerin Dr. Astrid Bühren. Sie spricht von einer neuen, "immensen Herausforderung bei der Finanzierung des Gesundheitswesens". Zudem fordert Bühren: "Psychische und psychosomatische Erkrankungen müssen in Studium und Weiterbildung verstärkt berücksichtigt werden - und zwar auch in den somatischen Fächern."
Praxisassistent Lischka hätte sich darüber gefreut. "Ich bin zwar fertig mit dem Studium, aber die Praxis ist oft anders und immer überraschend". Nun hofft der angehende Hausarzt, daß er noch viel von seiner erfahrenen Praxis-Kollegin lernen kann. Eines muß ihm jedoch keiner mehr beibringen. Lischka weiß, daß körperliche Beschwerden und psychische Belastungen oft miteinander einhergehen.
Zu einem 45jährigen mit Verdacht auf Magenschleimhautentzündung, der aus Sorge um den Arbeitsplatz seine Mittagspause für den Arztbesuch nutzt, sagt der junge Arzt: "Wir beide wissen, daß die Ursachen nicht im Magen, sondern im Streß auf der Arbeit und zuhause liegen, nicht wahr?" Eine etwa 50jährige Patientin mit einem Blutdruck von 180 zu 100 ermahnt Lischka nicht nur, regelmäßig ihre Medikamente einzunehmen, sondern auch ab und zu mal Ärger aus dem Berufsleben rauszulassen.
Die Bedeutung von Ärger als Triggerfaktor für einen Herzinfarkt ist seit Jahren nachgewiesen. Genauso unbestritten ist, daß psychische und soziale Ursachen bei der Entstehung vieler somatischer Erkrankungen eine Rolle spielen. Jedoch wird noch zu selten beachtet, daß körperliche Belastungsfaktoren ihrerseits wiederum die Seele leiden lassen können.
"Im einseitig somatisch orientierten Krankheitsverständnis vergessen wir oft, daß die somatische Verfassung immer Auswirkungen auf die Psyche hat", sagt der Berliner Klinik-Psychosomatiker Sprenger. Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie Diabetes oder koronarer Herzkrankheit entwickeln infolge ihrer körperlichen Symptomatik öfter als andere Menschen Depressionen oder Angststörungen.
So liegt die Prävalenz für eine manifeste Depression nach einem Herzinfarkt bei 20 bis 25 Prozent, während sie in der Gesamtbevölkerung fünf Prozent beträgt, sagt etwa Dr. Hans-Martin Rothe, Chefarzt der psychosomatischen Abteilung im Klinikum Görlitz.
Hausärzte sind oft erste Anlaufstelle bei Depressionen
Der Internist und Psychosomatiker berichtet von einem 42jährigen Herz-Patienten, der mit nervösen Herzbeschwerden, linksthorakalen Schmerzen, Atemnot, Angst und Panikattacken zu ihm in die Klinik kam. Zuvor hatte er einen Infarkt erlitten und ihm waren fünf Stents gelegt worden. Der Patient schilderte ein ständiges Druckgefühl in der Herzgegend, das seit dem Legen des letzten Stents nicht gewichen sei und wiederholt Auslöser für die Angst- und Panikattacken war.
Rothe diagnostizierte auch eine depressive Anpassungsstörung. Obwohl der 42jährige die psychotherapeutischen Behandlungsangebote zunächst ablehnt, kann Rothe ihm schließlich helfen. "Die depressive und herzphobische Symptomatik besteht zum Therapieende nicht mehr", sagt Rothe.
Doch nicht nur bei ihren Patienten, auch bei sich selbst sollten Ärzte stärker auf psychische Belastungen achten. Das empfiehlt Bernd Sprenger von der Oberberg-Klinik. Fast ein Drittel seiner Patienten sind Ärzte. Die Kollegen kommen vor allem wegen Burnout oder Suchterkrankungen zu ihm in Behandlung.
Praxisassistent Lischka weiß von der Gefahr. "Ich kann nur dann für meine Patienten da sein, wenn ich auch Zeit habe, mich zu regenerieren", sagt er. Lischka hat ausgerechnet, daß ihm bei überdurchschnittlichen Patientenzahlen pro Patient gerade mal fünf Minuten bleiben, wenn der Patient nur einmal im Quartal kommt und er sich als Arzt zehn Stunden pro Tag für die Patientenversorgung Zeit nimmt. Doch dann bleibt keine Zeit mehr für die Erholung, für seine Frau und den dreijährigen Sohn.
Lesen Sie dazu auch das Interview: Sprenger: "Wer nicht brennt, kann auch nicht ausbrennen"