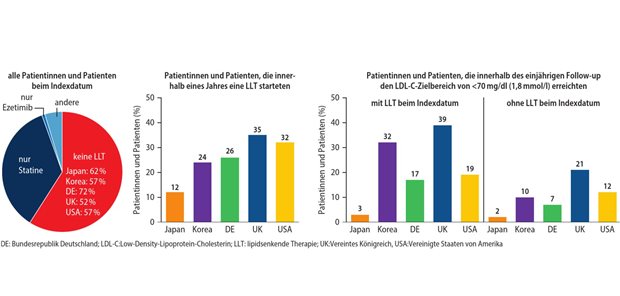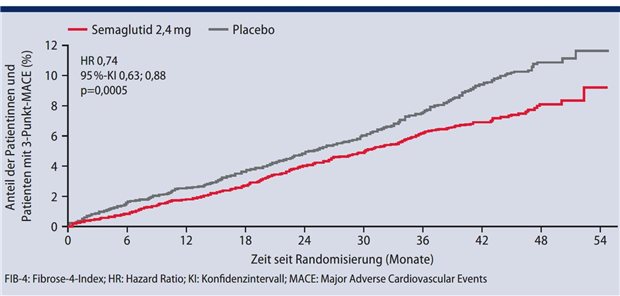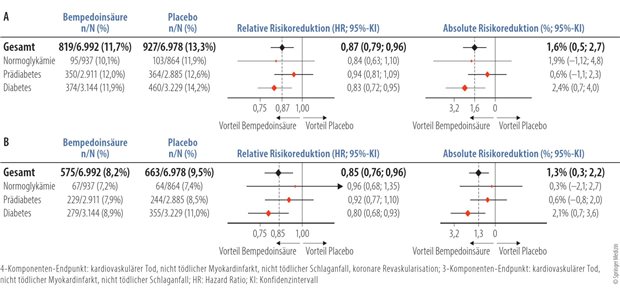Trauernde Eltern
"Hausärzte sind mit der Trauer oft überfordert"
Schnelle und kompetente Hilfe für Eltern ist nach dem Tod eines Kindes entscheidend. Petra Hohn, Trauerbegleiterin und Vorsitzende des Bundesverbands Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister, erklärt im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung", wie diese aussehen muss - und welche Rolle der Hausarzt im Trauerprozess spielt.
Veröffentlicht:Petra Hohn
1998 verloren Petra Hohn und ihr Mann ihren Sohn Carsten durch Suizid, er war 18 Jahre alt.
1999 wurden sie nach dem Besuch mehrerer Trauerseminare Mitglied im Bundesverband Verwaiste Eltern in Deutschland.
2003 schloss Petra Hohn die zweijährige Ausbildung zur Trauerbegleiterin ab.
2006 gab sie ihren Beruf als Bautechnikerin auf und leitet seitdem die Bundesgeschäftsstelle in Leipzig.
Ärzte Zeitung: Frau Hohn, wie hilft der Bundesverband Verwaiste Eltern Betroffenen?
Petra Hohn: Unter dem Dachverband vereinen wir alle Selbsthilfegruppen und Vereine für verwaiste Eltern in Deutschland und den angrenzenden deutschsprachigen Ländern.
Bei uns, der Bundesgeschäftsstelle, kann jeder Betroffene anrufen, wenn akut Hilfe benötigt wird - da die regionalen Gruppen ja meist ehrenamtlich arbeiten, können diese nicht dauerhaft besetzt sein.
Da hören wir dann erst einmal zu und vermitteln anschließend an die jeweiligen regionalen Anlaufstellen. Von uns bekommen die Betroffenen aber auch einen tröstendes Brief mit trostspendenden Texten, in denen beispielsweise andere Eltern ihre Geschichte erzählen.
Warum ist der Austausch mit anderen Eltern so wichtig?
Hohn: Die Betroffenen bekommen dabei das Gefühl: "Wir sind nicht alleine." Jedes Kind ist vielleicht auf einem anderen Weg gestorben, aber der Schmerz ist bei allen Eltern derselbe.
Wir helfen, das zu verstehen und so wieder eine psychologisch gesunde Sicht auf die Geschehnisse, aber auch die Trauer herzustellen.
Wie genau sieht Trauerarbeit aus?
Hohn: Wir sind mehr als nur eine Gruppe, die zusammen im Kreis sitzt und sich gegenseitig ihr Leid klagt. Das gehört natürlich auch dazu, aber darüber hinaus versuchen wir, lösungsorientiert zu arbeiten.
Wir schauen bei jedem Menschen individuell, wo es etwas gibt, was ihm Kraft gibt. Es geht darum, eine gewisse Lebensqualität zurückzugeben. Weil eigene Betroffenheit dabei aber nicht immer genügt, sind fast alle Gruppenleiter ausgebildete Trauerbegleiter.
Sie müssen erkennen, wo eine Co-Therapie mit einem professionellen Therapeuten unverzichtbar ist.
Gibt es auch Fälle, in denen die Aufarbeitung im Rahmen der Selbsthilfegruppe allein ausreicht?
Hohn: Ja, die gibt es durchaus. Wenn Menschen von Natur aus eine starke Resilienz haben, dann können sie den Verlust durchaus auch ohne professionelle Therapie aufarbeiten - unter der Voraussetzung, dass sie nach dem Verlust relativ schnell zu uns finden.
Hier bei uns lernen sie, quasi als Spiegel der eigenen Situation, dass es andere Menschen auch geschafft haben; andere verwaiste Eltern nehmen dann eine Art Vorbildrolle ein.
Nichtsdestotrotz brauchen auch diese Menschen ihre Zeit und müssen erst einmal wieder lernen, ihren Alltag ohne das verlorene Kind wieder neu zu ordnen.
Welche Rolle spielt der Hausarzt in diesem Prozess?
Hohn: Der Kontakt zum Arzt erfolgt relativ schnell nach dem Tod des Kindes, da die Eltern sich krankschreiben lassen. Mit dieser Trauer sind Hausärzte aber oft überfordert.
Zu schnell werden Betroffene aufgrund ihrer depressiven Symptome - die im Trauerprozess völlig normal sind - dann zum Therapeuten geschickt.
Wie müssten sich Ärzte verhalten?
Hohn: Betroffene befinden sich beim Erstkontakt mit dem Arzt noch im absoluten Schockzustand. Sie sind verwirrt, in ihrem Denken und Handeln extrem eingeschränkt, leiden unter starken Schuldgefühlen, suchen Erklärungen.
Für den Arzt ist das eine Herausforderung, denn sie müssen sich gerade für diese Patienten Zeit nehmen, was im Praxisalltag nicht immer einfach ist. Genau hier dürfen Ärzte aber nicht an den Therapeuten überweisen, da die Betroffenen Wochen warten, bis dieser für sie Zeit hat.
Hier müssen Ärzte auf Selbsthilfegruppen hinweisen. Jeder Hausarzt müsste von uns wissen, einen Flyer von uns in der Schublade liegen haben, Patienten womöglich selber direkt anmelden.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Medizinern?
Hohn: Zum Teil schon sehr gut. Es gibt eine Reihe von Kliniken, vornehmlich Geburtskliniken, die direkt nach einem solchen Verlust bei uns anrufen und erfragen, in welche regionale Gruppe ihre Patienten kommen dürfen.
In diesen Fällen gelangen die Betroffenen auf dem kürzesten Weg - ohne den Umweg über uns als Bundesgeschäftsstelle - an Hilfe.
Andere rufen an, nachdem der Arzt unsere Nummer weitergegeben hat.
Tatsächlich treten in den vergangenen Jahren aber vermehrt Ärzte und Kliniken an uns heran, mittlerweile erarbeiten wir gemeinsam sogar spezielle Kur-Angebote für Trauernde.
Die Zusammenarbeit von Selbsthilfegruppen und professioneller medizinischer Hilfe wird immer verzahnter - eine sehr positive Entwicklung. Denn um Betroffene zurück ins Leben zu führen, ist genau diese Mischung nötig.
Lesen Sie dazu auch: Verlust eines Kindes: "Der Schmerz ist bei allen Eltern derselbe"