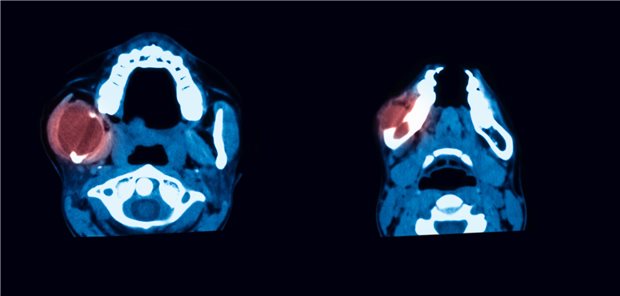Raumfahrt-Studie
Zweimonatige Bettruhe für die Wissenschaft
Forschung für die Raumfahrt: Zwölf Männer werden die Auswirkungen der Schwerelosigkeit im All testen - acht Wochen lang im Bett. Die Ergebnisse könnten auch für die Medizin interessant sein.
Veröffentlicht:
Ein Mann liegt gemütlich im Bett.
© Sean P. / panthermedia.net
KÖLN. Zwölf kerngesunde Männer legen sich für die Wissenschaft zwei Monate lang ins Bett. In dem Experiment werden die Folgen der Schwerelosigkeit für Astronauten simuliert.
Die ersten beiden Teilnehmer legten sich am Mittwoch ins Bett, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mitteilte.
Bei der DLR-Studie im Auftrag der Europäischen Raumfahrtagentur Esa dürfen die Probanden sich noch nicht einmal aufrichten - weder zum Essen noch zum Waschen.
Wie bei den Astronauten werden Muskeln und Knochen der unteren Körperhälfte abbauen. Wissenschaftler wollen testen, ob ein intensives Training an einem neuen Gerät während der Bettruhe effektiver gegen den Abbau ist als das herkömmliche Training.
Die Studie ist nach DLR-Angaben für alle Weltraummissionen wichtig, da der Abbau von Knochen und Muskeln dabei relativ schnell einsetzt.
Wadenmuskel schrumpft
Untersucht werden auch Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf Herz-Kreislauf-System, Gleichgewicht, Augen oder Nervensystem.
Die Betten sind leicht zum Kopf hin geneigt, damit die Körperflüssigkeiten wie in der Schwerelosigkeit Richtung Oberkörper gehen. "So simulieren wir die Auswirkungen der Schwerelosigkeit im All", sagte Studienleiter Edwin Mulder.
Was das im Einzelfall bedeuten wird, machte das DLR am Beispiel eines Ergotherapeuten deutlich, der an der Studie teilnimmt: Die Knochendichte an Beinen und Hüften werde voraussichtlich um zwei bis vier Prozent abnehmen. Muskeln in Beinen und Rücken werden abbauen - am stärksten der Wadenmuskel mit bis zu 25 Prozent.
Die Wissenschaftler wollen testen, ob ein intensives Training - natürlich auch im Liegen - an einem neuen Gerät gegen den Schwund effektiver ist als herkömmliche Verfahren. Dafür wird die Hälfte der Probanden trainieren, die Vergleichsgruppe nicht.
Starker muskulärer Reiz
"Ein kurzes knackiges Training mit einem starken muskulären Reiz - so etwas gibt es im All noch nicht", sagte Mulder vom DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin. Bis jetzt müssen Astronauten an Bord der internationalen Raumstation ISS zwei Stunden am Tag gegen den Schwund trainieren.
Die Testpersonen liegen in der DLR-Forschungseinrichtung "envihab" in Einzelzimmern mit einheitlich geregelter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Sie dürfen zwar keinen Besuch bekommen, aber mit Handy und Internet Kontakt zur Außenwelt halten.
Nach der Studie kommen die Teilnehmer in eine Reha-Maßnahme, um wieder Knochen und Muskeln aufzubauen. "Bisher wissen wir, dass Knochenabbau wieder vollständig reversibel ist, allerdings dauert es länger, bis der ursprüngliche Zustand erreicht ist - und diesen Mechanismus wollen wir besser verstehen", sagte der medizinische Leiter der Studie Ulrich Limper. Bis zu zwei Jahre nach der langen Bettruhe sollen noch fünf Nachfolgeuntersuchungen stattfinden.
Für eine zweite Studienphase Ende Januar sucht die DLR Testpersonen zwischen 20 und 50 Jahren. Interessenten müssen ein Verfahren durchlaufen mit der Beantwortung psychologischer Fragen, medizinischen Untersuchungen und einem psychologischen Interview.
Nicht die erste Studie unter extremen Bedingungen
Es ist nicht die erste Weltraum-Forschungsmission, für die Teilnehmer lange unter extremen Bedingungen verharren müssen: Von Juni 2010 bis November 2011 ließen sich sechs Freiwillige für 520 Tage in einer engen Raumkapsel einschließen, um einen Flug zum Mars in Echtzeit zu simulieren.
Die Mission "Mars 500" lief unter der Regie der Europäischen Raumfahrtagentur Esa und der russischen Weltraumagentur Roskosmos in Moskau und gilt als bisher längstes Isolationsexperiment der Weltraumwissenschaft.
Ein ähnliches, aber wesentlich kürzeres Experiment lief bereits 2009: Damals hatten sich sechs Männer für 105 Tage in eine Weltraumkapsel einschließen lassen. (aze/dpa)