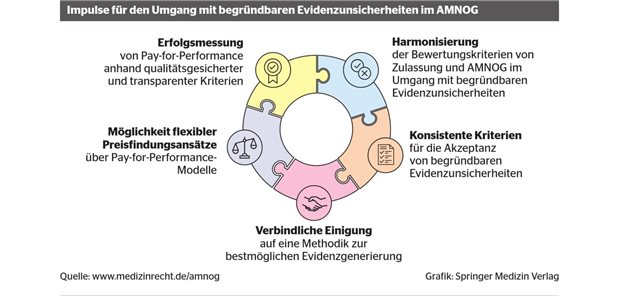Das IQWiG bleibt bei seiner Methodik - trotz Schwächen
Nach fast zweijähriger Vorarbeit hat das IQWiG sich auf eine Methodik für die Kosten-Nutzen-Bewertung festgelegt - die Kontroverse darum dürfte weitergehen.
Veröffentlicht:KÖLN. Das wissenschaftliche Beratungsinstitut des Gemeinsamen Bundesausschusses hält dabei an der von ihm entwickelten Methode der Effizienzgrenze fest. Maßstab für die Bewertung einer Arzneimittel-Innovation ist damit das Nutzen-Kosten-Verhältnis der Standardtherapie. Das Verfahren läuft in zwei Stufen: Zunächst wird eine reine Nutzen-Bewertung gemacht; zeigt sich danach ein Zusatznutzen der Innovation, so folgt im zweiten Schritt eine Kosten-Nutzen-Bewertung. Als effizient gilt das neue Arzneimittel dann, wenn das Verhältnis von Zusatznutzen zu Zusatzkosten mindestens genauso günstig ist, wie das Nutzen-Kosten-Verhältnis beim Standard. Dies lässt sich in einer einfachen Grafik abbilden, die zugleich einen Anhaltspunkt dafür gibt, welches der maximale Erstattungshöchstbetrag sein kann, den die Kassen einheitlich festlegen.
Bei der Bewertung von Nutzen und Kosten will das IQWiG zunächst nur die Perspektive der Krankenkassen berücksichtigen. Ferner soll der Einfluss zusätzlicher Ausgaben auf das Gesamtbudget der Kassen analysiert werden. Auswirkungen auf andere Sozialversicherungsträger - etwa Pflege- und Rentenversicherung - sowie gesamtwirtschaftliche Aspekte wie Produktivitätsgewinne können einbezogen werden.
Anders als das britische NICE will das IQWiG keine indikationsübergreifenden Kosten-Nutzen-Bewertungen. Die Effizienzanalyse ist also nur partiell auf eine Krankheit beschränkt. Das britische Modell einer krankheitsübergreifenden Betrachtung sieht Institutsleiter Professor Peter Sawicki als "utilitaristisch" und "gewinnmaximierend" an - das entspreche nicht der deutschen Kultur.
Einwände vieler Gesundheitsökonomen hat das IQWiG nicht berücksichtigt. Kernpunkt der Kritik: Je älter eine Standardtherapie ist, umso schwerer hat es eine Innovation, sich durchzusetzen. Die Gründe sind historisch niedrigere Kosten, Generika-Wettbewerb oder auch Festbeträge und Rabattwettbewerb bei älteren Medikamenten. Das Gesetz abnehmender Grenzproduktivität, das prinzipiell auch für die Forschung gilt, wird nicht berücksichtigt.