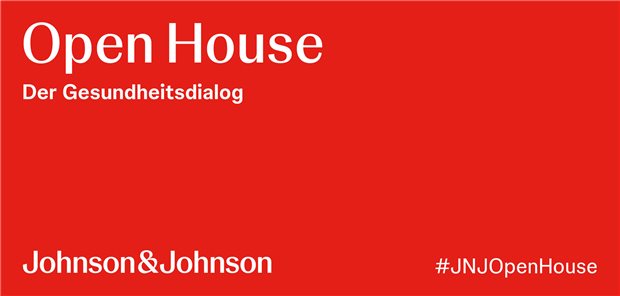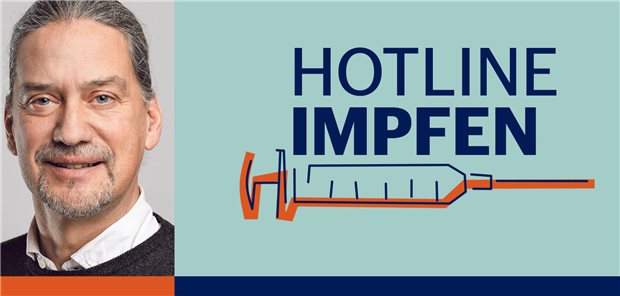Bundestagswahl: Rückblick
Die Agenda 2010 – Trauma und Erfolgsgeschichte
Sie wirkt bis heute nach, und in der SPD überwiegend als Trauma: die Agenda 2010, die untrennbar verbunden ist mit den „Hartz“-Reformen für den Arbeitsmarkt. Tatsache ist aber: Die zur Agenda gehörende Gesundheitsreform von 2003 brachte neben einschneidenden Sparmaßnahmen bis heute nachwirkende Veränderungen der ambulanten Versorgung. Davon profitiert heute vor allem der ärztliche Nachwuchs.
Veröffentlicht:
Bundeskanzler Gerhard Schröder am 1.6.2003 auf dem SPD-Sonderparteitag zur „Agenda 2010“ in Berlin. Er forderte rund 500 Delegierte auf, seinem Reformkonzept zuzustimmen.
© Miguel Villagran / picture-alliance
Berlin. „Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.“ Das war die Kernbotschaft der Agenda 2010, die Bundeskanzler Gerhard Schröder am 13. März 2003 mit einer Regierungserklärung startete – ein schmerzhafter Umbau des Arbeitsmarktes und des Gesundheitswesens, der Schröder 2005 die Kanzlerschaft kostete und der bis heute die SPD traumatisiert.
Nachdem Schröder in seiner ersten Amtsperiode – vergeblich – versucht hatte, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt und Sozialreformen im Konsens mit Wirtschaft und Gewerkschaften durchzusetzen und damit gescheitert war, machte er nun unmissverständlich den Primat der Politik klar: „Ich will nicht hinnehmen, dass Lösungen an Einzelinteressen scheitern, weil die Kraft zur Gemeinsamkeit nicht vorhanden ist.“
Ein Kernstück der Agenda waren die Hartz-Reformen, benannt nach dem vormaligen VW-Arbeitsdirektor Peter Hartz, der die Bundesregierung maßgeblich beraten hatte: Beschränkung des an das letzte Einkommen gekoppelte Arbeitslosengeld auf zwölf Monate, Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und Ersatz durch das Arbeitslosengeld II (ALG II), dessen Höhe auf das Sozialhilfeniveau abgesenkt wurde („Hartz IV“), Zusammenlegung mit der Sozialhilfe und Verlagerung in die Zuständigkeit der Arbeitsagenturen, Zumutbarkeit einer jeden Arbeit, die nicht sittenwidrig ist, mit Sanktionsbewehrung.
„Hartz“ – ein Programm der Zumutungen für SPD-Kernwähler
Ein Programm der Zumutungen, insbesondere für die Kernwählerschaft der SPD. Die Effekte sind ambivalent und werden bis heute kontrovers diskutiert. Tatsache ist: Die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die Absenkung der Leistungsniveaus der Arbeitslosenversicherung begann erst drei Jahre nach Start der Agenda-Politik zu wirken. Bis 2006 stieg die Arbeitslosenquote noch von 9,6 Prozent (2003) auf über 11,7 Prozent – sank dann aber kontinuierlich bis auf 5,0 Prozent im Jahr 2019.
Die Zahl der Erwerbstätigen stieg in dieser Zeit von 39,2 auf 45,3 Millionen Menschen – ein Zuwachs von 6,1 Millionen Arbeitsplätzen. In fast gleichem Ausmaß stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 27 auf rund 33 Millionen, rund sechs Millionen neue Beitragszahler, die die Finanzen der Sozialversicherungen maßgeblich stabilisieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein großer Niedriglohnsektor mit prekären Beschäftigungsverhältnissen (Ich-AGs und Minijobs) mit einem erheblichen Armutspotenzial entstanden ist.
Unter Ökonomen sind die Effekte insbesondere der Hartz-Reformen umstritten. Argumentiert wird, dass einerseits eine schon seit langem zurückhaltende Tarifpolitik der Gewerkschaften, andererseits die Schaffung des Euro-Raums erheblich mehr zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft beigetragen haben.
Geblieben ist: Insbesondere die Hartz-Reformen sitzen wie ein Pfahl im Herzen der Sozialdemokratie. Alle Korrektur- und Wendemanöver von SPD-Sozialpolitikern der Nach-Schröder-Zeit haben es nicht vermocht, das Trauma zu überwinden. Bis heute haben sie ihre Bußgewänder nicht abgelegt.
Die Kassen im Wettbewerb – ein Sog ins Schuldental
Eine Sonderrolle in der Agenda 2010 spielte die Gesundheitspolitik. Anfang 2001 hatte die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt, eine gelernte Sonderschullehrerin, das Gesundheitsressort von der an der BSE-Krise gescheiterten Andrea Fischer (Grüne) übernommen. Die hatte ein Jahr zuvor eine hochkomplexe Gesundheitsreform mit zahlreichen strukturellen Veränderungen wie beispielsweise die Einführung der integrierten Versorgung bewerkstelligt. Ein unvollendetes und dysfunktionales Erbe für Schmidt.

Ulla Schmidt und Horst Seehofer, 2003.
© Stephanie Pilick / picture-alliance
Vor allem aber krankte auch die GKV Anfang der 2000er Jahre an einer fundamentalen Einnahmeschwäche – und dies nicht nur, weil die Wirtschaft lahmte. Vielmehr wurden die Nebenwirkungen des von Horst Seehofer eingeführten Kassenwettbewerbs und Kassenwahlrechts der Versicherten sichtbar: mit immer stärker divergierenden Beitragssätzen zwischen den AOKen auf der Verlierer- und den Betriebskassen auf der Gewinnerseite. Es waren vor allem die jüngeren, flexibleren Beitragszahler, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten – gute Risiken wechselten in Kassen mit niedrigen Beitragssätzen, die Morbiditätslast verblieb bei den Ortskrankenkassen.
Die Schwächen einer dysfunktionalen Rechtsaufsicht der Kassen
In dieser Gemengelage wirkte die bis heute dysfunktional organisierte Kassenaufsicht verhängnisvoll: Anders als Ersatz- und die meisten Betriebskassen sind für die AOKen die Landesgesundheitsminister als Rechtsaufsicht zuständig – und diese Minister betrachteten „ihre AOK“ quasi als ihr ureigenes sozialpolitisches Kapital, das es zu schützen galt. Unbemerkt von der Öffentlichkeit genehmigten die Länderminister „ihren AOKen“ Haushalte und Beitragssätze, die zwangsläufig in die Schuldenfalle führen mussten. Maßgeblicher Grundsatz war, dass steigende Beitragssätze vermieden werden sollten, um die AOK vor Mitgliedsverlusten zu schützen. Auch Ulla Schmidt selbst war vor der Bundestagswahl im September 2002 wenig daran gelegen, den wachsenden Schuldenberg der GKV transparent zu machen.
Die Quittung kam im Frühjahr 2003: Das Vorjahr hatten die Kassen mit einem Defizit von rund drei Milliarden Euro abgeschlossen; der saldierte Schuldenstand aller Kassen erreichte 11,3 Milliarden Euro. Und damit wurde ein Kostendämpfungs- und Reformprogramm im gesamten deutschen Medizinbetrieb zum Bestandteil der Agenda 2010. Ähnlich wie schon beim legendären Kompromiss von Lahnstein, war auch diesmal die Opposition, jetzt mit ihrem Verhandlungsführer, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von CDU/CSU, Horst Seehofer, dabei – allerdings ohne die FDP.
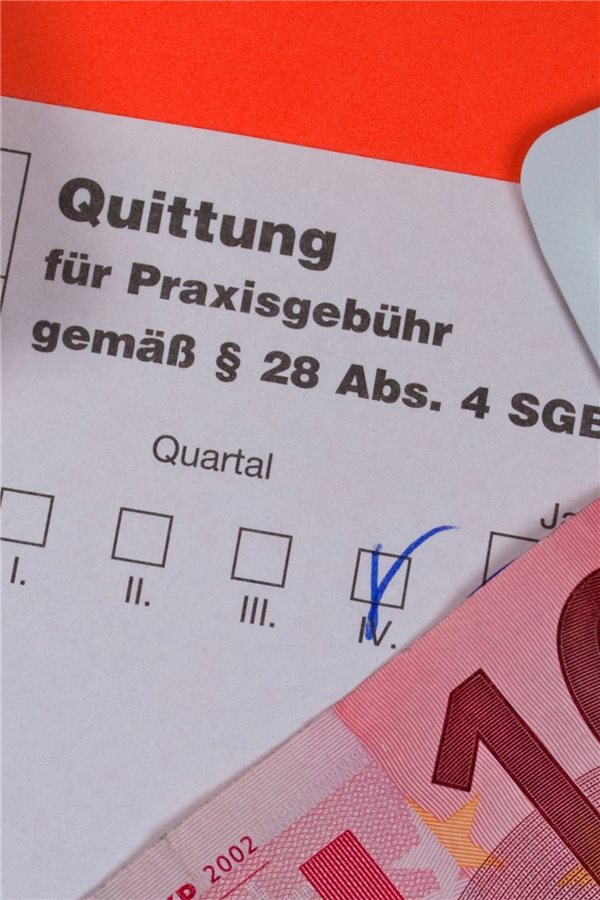
Die Praxisgebühr von 10 Euro wurde eingeführt.
© M. Schuppich / stock.adobe.com
Kostendämpfung ohne Tabu: Die Registrierkasse in der Praxis
In den 14 Tage dauernden Verhandlungen zimmerten Schmidt und Seehofer einen Kompromiss, der es „in sich“ hatte und der keine Tabus kannte: Gesamtvolumen 9,9 Milliarden Euro Einsparungen – eine Reform, „die mindestens fünf Jahre halten soll“, wie Schmidt und Seehofer versicherten. Zusammengestellt hatten sie einen Instrumentenkasten, der tief in die Besitzstände von Patienten, Versicherten, insbesondere aber auch der Pharma-Industrie eingriff:
- Die Praxisgebühr von zehn Euro im Behandlungsfall; bei Überweisung durch den Hausarzt konnte die Praxisgebühr beim Facharzt vermieden werden – eine Stärkung der hausärztlichen Koordinationsfunktion. Die Einnahmen der Ärzte aus der Praxisgebühr werden mit ihrem Honoraranspruch gegen die KV verrechnet.
- Patienten müssen bei allen veranlassten Leistungen zehn Prozent Zuzahlung leisten, mindestens fünf Euro, höchstens zehn Euro. Für die ersten 14 Tage eines Krankenhausaufenthalts werden zehn Euro Zuzahlung pro Tag erhoben.
- Die Belastungsobergrenze für Zuzahlungen liegt bei zwei Prozent, für chronische Kranke bei einem Prozent (bis dahin keine Zuzahlung).
- Leistungskürzungen: Sterbegeld, Entbindungsgeld, medizinisch nicht notwendige Sterilisation, Zuschüsse für Sehhilfen sowie Fahrtkosten zur ambulanten Behandlung werden komplett gestrichen, die Zuschüsse zur künstlichen Befruchtung halbiert.
- Zahnersatzleistungen sollen GKV-Versicherte ab 2005 privat absichern und müssen das Krankengeld ab 2006 allein finanzieren (der Vorläufer des Zusatzbeitrags der Versicherten).
- Rentner müssen Betriebsrenten und Einkünfte aus selbstständiger Arbeit voll verbeitragen.
- Der gesetzliche Rabatt für Arzneimittel ohne Festbetrag wird von 6 auf 16 Prozent erhöht; Festbeträge sind auch für patentgeschützte Arzneimittel zulässig.
- Alle rezeptfreien Arzneimittel sind nicht mehr erstattungsfähig, eine Ausnahme gilt für Kinder; im Gegenzug entfallen weitere Negativlisten und die Positivliste. „Lifestyle“-Arzneimittel („Viagra“) sind keine Kassenleistung mehr.
- Die Apothekenvergütung wird umgestellt. Der bisherige prozentuale Aufschlag wird weitgehend durch einen Festaufschlag ersetzt, damit werden zwar Generika etwas teurer, aber teure patentgeschützte Arzneimittel für die Kassen teils deutlich billiger.
Das Kostendämpfungspaket des GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG), das am 1. Januar 2004 in Kraft trat, traf vor allem Patienten und Versicherte, und unter den Leistungserbringern vor allem die Pharma-Industrie mit dem 16-prozentigen Zwangsrabatt, der allerdings nur ein Jahr gelten sollte. Die Ärzte waren zwar durch die Praxisgebühr mit dem für sie ungewohnten Inkasso betroffen und mit Bürokratie belastet, blieben ansonsten aber weitgehend verschont.

Die Praxisgebühr war umstritten: Rolf Heyde, Pressesprecher der niedersächischen Ärztekammer, hält die Plakate verschiedener Ärzteorganisationen am 5.1.2004 hoch.
© Wolfgang Weihs / dpa
Reformen für die ambulante Versorgung: Das MVZ kommt
Von nachhaltiger Bedeutung waren allerdings die strukturellen Reformen des GMG, die bis heute nachwirken und die die Arbeit insbesondere der niedergelassenen Ärzte fundamental verändern sollten. Eine der wichtigsten Neuerungen war die Einführung Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) in der Trägerschaft von Vertragsärzten oder anderer Institutionen im Gesundheitswesen.
Die MVZ entwickelten sich zu einer Erfolgsgeschichte, auch wenn sie in ihrer Struktur denen der verschmähten Polikliniken der DDR ähneln, um die es in der Phase der Wiedervereinigung 1990 noch heftige ideologische Auseinandersetzungen gegeben hatte. Die Zahl der MVZ ist inzwischen auf rund 3500 (Stand Ende 2019 laut KBV) gestiegen und wächst weiter. 42 Prozent werden von Vertragsärzten, 43 Prozent von Kliniken getragen. 92 Prozent der Ärzte arbeiten im Angestelltenverhältnis, häufig in Teilzeit.
Die Organisation des MVZ kommt den Berufswünschen insbesondere vieler jüngerer Ärzte entgegen: interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kollegen und anderen Berufsgruppen, Arbeiten in der ambulanten Versorgung ohne die Belastungen und Risiken des Freiberufler-Status, Möglichkeit von Teilzeitarbeit und gute Work-Life-Balance.
Schub für die Integrierte Versorgung und die HzV
Einen neuen Anlauf unternahmen Schmidt und Seehofer bei der Integrierten Versorgung, die aufgrund komplizierter Budgetbereinigungsregeln seit 2000 nicht in Gang gekommen war. Etwas grobschlächtig, aber pragmatisch, zweigten sie aus den Budgets der Ärzte und Krankenkassen ein Prozent des Geldes ab und stellten dies für die Integrationsversorgung zu Verfügung – in der Folge blühte die Vertragslandschaft, wenn auch etwas wildwüchsig.
Maßgeblich gestärkt wurde die hausarztzentrierte Versorgung (HzV) – zwar nicht durch Geld, aber durch die Verpflichtung der Krankenkassen, Verträge darüber abzuschließen. Für die Versicherten blieb das Angebot freiwillig – für den Hausärzteverband war es ein großer Erfolg, der ihn zu einem wichtigen alternativen Player im Wettbewerb zum Vertragsgeschäft der KVen machte. Neben den Kollektivverträgen der KV konnte nun auch der Hausärzteverband eigene HzV-Verträge bundesweit oder regional vereinbaren – ein Erfolgsmodell zumindest in Baden-Württemberg.
Qualität und Qualitätswettbewerb erhielten einen neuen Stellenwert. Ärzte wurden durch eine Pflichtfortbildung in die Pflicht genommen – und mit Vergütungsabzug, im Extremfall sogar mit Entzug der Zulassung sanktioniert. Auf dieser Basis begannen die Kammern, ein Punktesystem für zertifizierte Fortbildungen zu etablieren – der Einfluss der Pharma-Industrie wurde damit in der ärztlichen Fortbildung zurückgedrängt.
Neues Instrument der Nutzenbewertung
Neu war auch das Instrument der Nutzenbewertung von neuen Arzneimitteln und solchen Medikamenten, die von besonderer Bedeutung in der Versorgung sind. Für die Nutzenbewertung zuständig wurde das neu zu gründende Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Zuständigkeitsbereich des Gemeinsamen Bundesausschusses, der die Aufträge an das Institut erteilt.
Im Herbst 2004 wurde das Institut gegründet – die von ihm entwickelten Methoden wurden in der Fachöffentlichkeit kritisch begleitet. Es gelangen nur vereinzelte Nutzenbewertungen – etwa von Insulinen –, und sie waren umstritten, ebenso wie die Methoden des Instituts, mit denen der Zusatznutzen monetär bewertet werden sollte.
Themenseite
Alles zur Bundestagswahl 2025
Erst die Einführung der frühen Nutzenbewertung durch AMNOG ab 2011 brachte den Durchbruch. Dennoch darf das GMG als der Startschuss für die Arbeit an einer neuen Ära der Evidenzbasierung der medizinischen Versorgung gelten. Und nach ersten Jahren eines schwierigen Aufbaus hat sich das IQWiG heute einen international anerkannten Ruf unter den HTA-Institutionen erarbeitet.
Schlussendlich stellte das GMG den Vertragsärzten auch ein Ende der Budgetierungsphase mit einer Rückkehr zu festen Punktwerten in Aussicht. Aber dies war ein Plan, der bis 2007 reichen sollte – in Wirklichkeit aber weitaus länger dauerte, als Reformer sich das erhofft hatten.
Strukturelle Reformen, die sich als tragfähig erwiesen
Unter dem Strich bleibt: Neben dem harten und schmerzhaften Kostendämpfungspaket enthielt das GMG weitreichende strukturellen Reformen, die sich als tragfähig erwiesen haben. Für Ärzte in der ambulanten Versorgung hat diese Reform neue Perspektiven eröffnet.
Wie fundamental sich der Markt für ärztliche Arbeitskraft Anfang der 2000er Jahre verändert hatte, zeigt eine andere Entscheidung: die Abschaffung des AiP 2004. 20 Jahre lang hatten approbierte Ärzte nach ihrem Staatsexamen 18 Monate für ein halbes Gehalt nur unter der Aufsicht anderer Ärzte arbeiten dürfen – die Praxisphase sollte nach dem Willen von Politik und Ärztefunktionären 1984 ein Abschreckungsinstrument für den Nachwuchs sein. Ulla Schmidt hat unter diese Phase einen Schlussstrich gezogen.
Die positiven Chancen und Wirkungen dieser Reformen wurden in ihrer Tragweite damals weder von Ärzten und erst recht nicht von der potenziellen Wählerschaft der SPD gesehen. Die vorgezogene Bundestagswahl 2005 verlor Gerhard Schröder knapp an seine Rivalin Angela Merkel. Als Kanzlerin setzte sie – in der ersten Großen Koalition mit der SPD 2005 bis 2009 – in der Gesundheitspolitik gemeinsam mit Ulla Schmidt die Reformagenda fort.