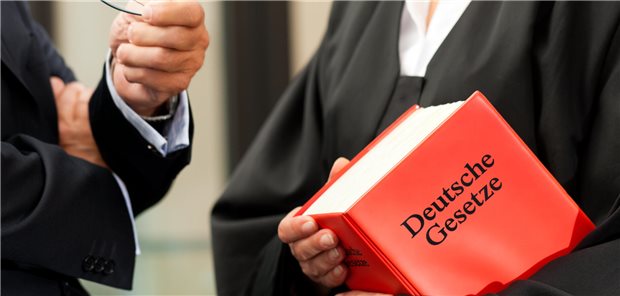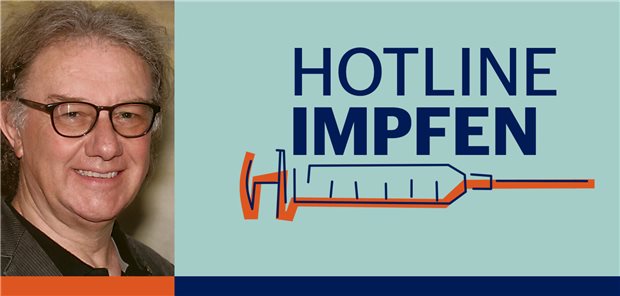Kolumne aus Berlin
Die Glaskuppel über Notpflaster für die Sozialversicherungen: Nachhaltig geht anders
Die Koalition greift bei der Finanzierung der Gesundheitsversorgung zur Notlösung. Darlehen helfen dem Finanzminister, den Haushalt buchhalterisch aufzuhübschen. Versorgungszielen und ihrer nachhaltigen Finanzierung dient das eher nicht.