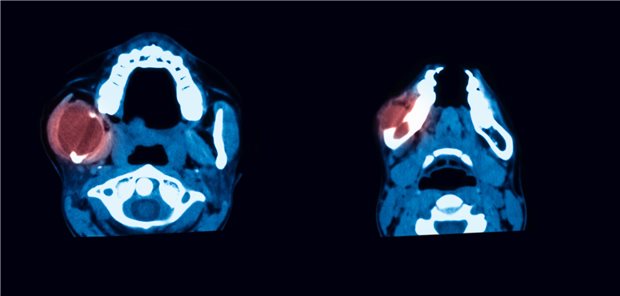Ein Präsident, der das Gesundheitssystem verändern will
Er will erreichen, dass alle Bürger seines Landes bei Krankheit gut versorgt werden: Wird der neue US-Präsident Barack Obama seine ehrgeizigen Pläne auch umsetzen können?
Veröffentlicht:
Schwere Bürde: Barack Obama tritt sein neues Amt an
© Foto: imago
Menschen in Deutschland, die vom Wert einer solidarischen Krankenversicherung überzeugt sind, muss dieses politische Verhalten irritieren: Warum hat der scheidende US-Präsident George W. Bush gleich mehrmals mit Vehemenz einen Gesetzentwurf im Kongress abgelehnt, der eine staatliche Krankenversicherung für vier Millionen Kinder aus einkommensschwachen Schichten vorsah? War das mangelnde Sensibilität für Menschen, denen doch eigentlich die Zukunft des Landes gehören sollte?
Erster Erfolg im Repräsentantenhaus
Bush ist ein Politiker von gestern. Eine Woche vor seinem Amtsantritt hat sein Nachfolger Barack Obama bereits einen ersten Erfolg im Repräsentantenhaus verbucht. Die Demokraten haben mit klarer Mehrheit den lange umstrittenen Entwurf verabschiedet, der Millionen Kindern bei Krankheit mehr Sicherheit bieten wird. Das Gesetz benötigt zwar noch die Zustimmung des Senats, aber das scheint mit Blick auf eine klare demokratische Mehrheit auch in diesem Haus sehr wahrscheinlich. Obama hat ein klares Signal gesetzt: In Zeiten der Krise muss jedes Kind krankenversichert sein, sagt er. Der neue Präsident setzt darauf, dass er die Vorlage nach seinem Amtsantritt am heutigen Dienstag als eines der ersten Gesetze unterschreiben kann.
Im Wahlkampf hat Obama seine gesundheitspolitischen Kernziele immer wieder klar formuliert. Ob er sie mit Blick auf die dramatische Wirtschaftskrise auch realisieren kann und ob er dabei immer konsequenten Rückhalt seiner demokratischen Parteifreunde haben wird, ist derzeit allerdings noch nicht abzusehen.
Der neue Präsident will eine staatliche Krankenversicherung einführen, die private Versicherungen ergänzen soll. Sie richtet sich an Menschen jünger als 65, die keinen Versicherungsschutz über ihren Arbeitgeber erhalten können und auch nicht durch Medicaid, die Versicherung für Bedürftige, abgesichert sind.
Obama will darüber hinaus kontrollierte Alternativen auf dem privaten Versicherungsmarkt schaffen ("National Health Insurance Exchange"), deren Leistungs- und Beitragsniveau klar definierten Anforderungen entsprechen müssten;
- er will Arbeitgeber verpflichten, sich an den Versicherungskosten ihrer Mitarbeiter zu beteiligen oder in die neue nationale Versicherung einzuzahlen;
- er will Versicherungen gesetzlich untersagen, Menschen wegen ihres Gesundheitszustands abzulehnen;
- er will Bürgern mit niedrigen Einkommen Finanzhilfen zukommen lassen.
Eine allgemeine Versicherungspflicht - zentraler Bestandteil im Reformplan seiner ehemaligen Rivalin Hillary Clinton - hat Obama bisher abgelehnt. Seine Begründung: Zunächst müsse gewährleistet werden, dass es überhaupt erschwingliche Versicherungsoptionen für alle Landsleute gebe.
Obama wird Präsident eines Landes, in dem es immense Unterschiede als Folge sozialer Ungleichheit gibt. Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA liegt Berechnungen des britischen Epidemiologen Sir Michael Marmot zufolge bis zu 18 Jahre auseinander. Weiße Männer haben in den bestversorgten Gebieten eine Lebenserwartung von 76,4 Jahren, in schlecht versorgten Gebieten (etwa Washington D.C.) liegt sie in der Gruppe der schwarzen Männer bei 57,9 Jahren.
Ein Grund für dringend notwendige Veränderungen auch mit Blick auf eine bessere Gesundheitsversorgung? Victor R. Fuchs, emeritierter Ökonomie-Professor von der Stanford-University, bleibt skeptisch. Warum wird so oft über Gesundheitsreformen in den USA geredet, und dennoch passiert so wenig?, fragt er in einem Betrag, der im New England Journal of Medicine (360: 208-209) veröffentlich worden ist.
Reformer waren stets uneins
Fuchs nennt Knackpunkte: Bei allen Reformvorschlägen der Vergangenheit sei es bisher nie gelungen, die geballten Interessen der Reformer unter einen Hut zu bringen. Viele gesellschaftlich relevanten Gruppen mit viel Einfluss, etwa große Wirtschaftsunternehmer, hätten gar kein Interesse an Veränderungen. Firmen mit vielen jungen, gesunden Arbeitnehmern befürchten höhere Kosten für die Gesundheitsversorgung, Wirtschaftsmanager lehnten oft aus ideologischen Gründen das Prinzip "Mehr Staat" grundsätzlich ab.
"What We Can Do About the Health-Care Crisis?" Diese Frage hat der neue US-Gesundheitsminister Tom Daschle in einem Buch gestellt, das im vergangenen Sommer vorgestellt wurde. Bei seiner Suche nach Antworten beschäftigte er sich intensiv mit Versorgungssystemen in Europa. Auf einer PR-Tour für das Buch soll er den besonderen Wert des deutschen Gesundheitssystems gepriesen haben: Dieses Land habe das Glück, so Daschle, dass es eine mehr als hundertjährige Tradition der Sozialversicherung seit Bismarck besitze. Deutschland als Vorbild für die USA - könnte das eine Option für Barack Obama sein?
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Ein schweres Stück Arbeit
US-Versicherungslobby ist offen für Obama-Pläne
Die Idee einer allgemeinen Versicherungspflicht gewinnt auch außerhalb von Kongresskreisen an Popularität: So haben zum Beispiel kürzlich zwei der größten Versicherungslobbies - die AHIP (America's Health Insurance Plans) sowie die BCBSC (Blue Cross Blue Shield Association) - verlauten lassen, dass ihre Mitglieder bereit wären, allen US-Bürgern eine Versicherung anzubieten. Das bedeutet: Sie würden niemanden mehr wegen Alter oder Krankheit ablehnen. Die Lobbies haben ihr Angebot allerdings mit der Forderung verknüpft, dass eine Versicherungspflicht für alle US-Amerikaner eingeführt wird. Die Interessenvertreter argumentieren, dass eine allgemeine Versicherungsgarantie mit einer individuellen Versicherungspflicht einhergehen müsse, weil sich sonst viele Bürger erst dann versichern würden, wenn sie Gesundheitsprobleme hätten.
Dass die Versicherungen überhaupt eine Versicherungsgarantie unterstützen, grenzt für manche Beobachter an ein Wunder. An dem erbitterten Widerstand der Versicherungslobbies lag es nämlich auch, dass Bill Clinton mit seinem Reformversuch Anfang der 90er Jahre scheiterte.
Nicht nur die Versicherungen haben ihre Meinung seit der Ära Clinton geändert. Auch Unternehmensverbände signalisieren inzwischen Offenheit mit Blick auf eine Gesundheitsreform. (cp)
Demokraten mit klarer Mehrheit
Die Demokraten haben zum Start der Ära Obama eine komfortable politische Ausgangslage: Sie verfügen in beiden Häusern des US-Kongresses, im Senat und im Repräsentantenhaus, über eine Mehrheit. 58 der 100 Senatoren gehören der demokratischen Partei an, 41 sind Republikaner, ein Senatorensitz ist derzeit offen. Die aktuelle Sitzverteilung im Repräsentantenhaus: 257 Demokraten, 178 Republikaner. Mit der Wahl des Präsidenten dominieren die Demokraten damit die US-Gesezgebungsinstitutionen. (fuh)
Versichert oder nicht versichert?
In den USA ist jeder Bürger selbst für seinen Krankenversicherungsschutz verantwortlich. Rund 60 Prozent der Bürger sind über ihren Arbeitgeber versichert. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Leistung, auf die Arbeitnehmer keinen Anspruch haben. Die Zahl der Arbeitgeber, die dieses Angebot machen, sinkt - vor allem gilt das für kleinere Unternehmen. Bei Jobverlust oder Arbeitgeberwechsel endet das Versicherungsverhältnis.
15,3 Prozent der Bürger sind überhaupt nicht versichert. 8,9 Prozent haben sich selbst versichert, 27,8 Prozent sind durch ein Sozialprogramm der Regierung versichert (manche Bürger nehmen Versicherungen aus mehreren Bereichen in Anspruch). Eine staatliche Krankenversicherung gibt es für Menschen ab 65 Jahren (Medicare) und für wirtschaftlich Schwache (Medicaid). Für alle anderen nicht privat Versicherten gibt es nur eine kostenlose Behandlung in medizinischen Notfällen. Andere Behandlungen müssen privat finanziert werden.
Problematisch ist die Situation für Menschen, die zu arm sind, um sich eine Versicherung leisten zu können, aber auch keine Ansprüche auf Medicaid haben. Sie bleiben oft ohne Versicherung. Vor allem Kinder aus diesen Familien sollen von einem neuen Gesetz profitieren, das Barack Obama möglichst schnell unterzeichnen will. (eb)