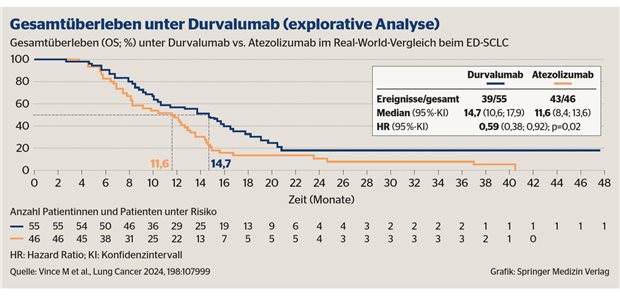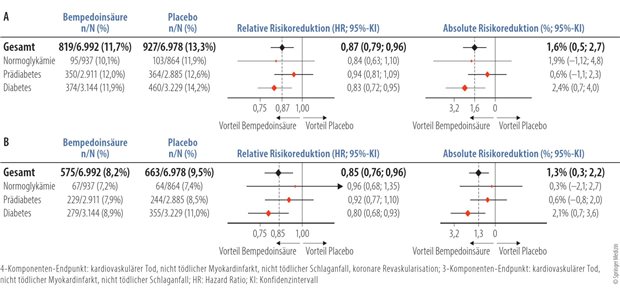Editorial
Wenn Globalisierung auf deutsche Sozialpolitik trifft
Der Zuzug hunderttausender Flüchtlinge stellt die Sozialsysteme in Deutschland auf eine große Probe. Trotz bürokratischer Mängel funktioniert die Gesundheitsversorgung - mit Auswirkungen auf die nächsten Reformen.
Veröffentlicht:
Gerhard Bojara, Chef des Gesundheitsdienstes Osnabrück, bei der Erstuntersuchung des kurdischen Flüchtling Mohamad.
© Ingo Wagner / dpa
Es ist schon etwas befremdlich, wenn auf den großen Parteitagen von CDU und SPD die Gesundheitspolitik fast völlig ausgeklammert wird. Das vermittelt die Botschaft: Der Gesundheitsminister hat die Probleme im Griff - fast im Monats-Rhythmus werden neue Gesetze verabschiedet, alles gut.
Die Delegierten können sich somit den großen Themen dieser Tage zuwenden. Und angesichts zunehmender Krisen in der Welt als Folge von Terror und Krieg, die Menschen immer häufiger zur Flucht zwingen, erscheint der Rückgang des Finanzpolsters in der gesetzlichen Krankenversicherung von 25,5 auf 23,8 Milliarden Euro oder die Unwucht beim Morbi-RSA vergleichsweise marginal.
Das gilt allemal für die Diadochenkämpfe einer erodierenden Selbstverwaltung auf Bundesebene - kleinlich und peinlich. Selbst der aufsichtsrechtliche Eingriff des Ministeriums ist allenfalls eine Randnotiz in der öffentlichen Wahrnehmung.
Zum entspannten Zurücklehnen in der Gesundheitspolitik gibt es indes keinen Anlass, denn die großen Fragen, die sich nur schwer in Spiegelstrichen im Sozialgesetzbuch V abbilden lassen, sind weiter ungelöst.
Leistungsverbesserungen kosten Milliarden
Gewiss hat die Koalition wie versprochen eine Lawine von Gesundheitsgesetzen losgetreten. Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz, dem Präventionsgesetz, der Debatte um die Hospiz- und Palliativbetreuung, mit der zweiten Stufe der Pflegereform sowie der Klinikreform sind große Gesetze verabschiedet worden, von denen manche schon als abgeschrieben galten -Stichwort Präventionsgesetz.
Das dürfte nun die letzten Skeptiker überzeugt haben, die noch zu Beginn der Legislaturperiode prophezeit hatten, dass sich die Koalition nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen würde. Der Minister hat geliefert und pflichtbewusst die Agenda des Koalitionsvertrags abgearbeitet.
Dabei darf nicht übersehen werden, dass für Leistungsverbesserungen bis zum Jahr 2020 annähernd 40 Milliarden Euro ausgegeben werden. Hinzu gerechnet werden müssen Leistungen aus dem gesundheitspolitischen Pflichtenbuch der restlichen Legislaturperiode. Wer soll da schon etwas gegen einzuwenden haben?
Zugang zur Versorgung uneinheitlich
Eine Herausforderung der besonderen Art ist die Versorgung der vielen Flüchtlinge, die auf unbestimmte Zeit zu Hunderttausenden nach Deutschland kommen werden. Dass deren gesundheitliche Versorgung leidlich gut funktioniert, ist wie in vielen anderen Bereichen dem großen ehrenamtlichen Engagement vieler freiwilliger Ärztinnen und Ärzte zu verdanken.
Ohne deren Unterstützung wäre die Versorgung längst zusammengebrochen. Zum Glück erweisen sich die über Jahre gewachsenen regionalen Versorgungsstrukturen als elastisch und flexibel - ganz im Gegensatz zur staatlichen Administration, deren Dauerversagen Abend für Abend über die Bildschirme flimmert.
Bittere Wahrheit ist: Jedes Bundesland hat seine Eigenheiten in puncto Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen mit der Folge uneinheitlicher Versorgungsumfänge - ob mit oder ohne Krankenversichertenkarte.
Das Beispiel der Flüchtlingsversorgung macht aber auch deutlich, dass vieles dem Zufall und nur weniges auf nachhaltige Strategie und weitsichtige Planung zurückzuführen ist. Das mag auch insgesamt für eine weitsichtige Gesundheitsversorgung gelten.
Im Grundsatz geht es darum, die Balance zwischen den medizinischen Möglichkeiten und den zur Verfügung stehenden Mitteln zu halten. Um dies zu gewährleisten, gehören die klassischen Versorgungsstrukturen auf den Prüfstand.
Ja, es ist richtig, Anreize für Netze und andere Kooperationen zu geben. Aber Hand aufs Herz: Wer mag den Satz noch hören, dass die Sektorengrenzen überwunden werden müssen? Wie oft sind Überwindungsversuche ins Leere gelaufen?
Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung ist nur ein Beispiel dafür, wie schwer sich die Selbstverwaltung tut, politisch eröffnete Handlungsspielräume zu nutzen.
Und es geht nicht nur um die Strukturen, sondern um die Herausforderungen, die etwa mit der demografischen Entwicklung einhergehen. Seit Jahren prognostizieren Experten steigende Zahlen chronisch Kranker, etwa beim Diabetes und dessen Folgeerkrankungen oder bei neurodegenerative Erkrankungen.
Ebenso werfen Therapiefortschritte bei Krebs Fragen auf, etwa nach dem Stellenwert eines progressionsfreien Überlebens im Vergleich zum Gesamtüberleben. Ist die Solidargemeinschaft bereit, die hohen Kosten dafür zu übernehmen?
Neue Medizin trifft auf alte Strukturen
Welche Erwartungen Vertreter aus Wissenschaft, Politik und ärztlicher Selbstverwaltung an ein Zusammenwirken von Wissenschaft und Gesundheitspolitik haben, wurde kürzlich in einem Symposium zur Versorgungsforschung deutlich.
Dessen ernüchterndes Fazit: Seit Jahrzehnten erfolgt Versorgung im Blindflug und nicht nach validen Kriterien. Die Skepsis gegenüber Leitlinien ist immer noch weit verbreitet. Versorgung orientiert sich mehr an ökonomischen als an medizinischen Notwendigkeiten. Flankiert werde diese Entwicklung durch ein Austrocknen oder Kaputtsparen der medizinischen Hochschulforschung.
Professor Michael Hallek wundert es daher nicht, wenn nur noch 10 bis 15 Prozent junger Internisten in die Forschung gehen, sagt das Mitglied der Senatskommission für klinische Forschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). In puncto Versorgungsstrukturen legte Professor Thomas Mansky von der TU Berlin nach: "Wir machen die Medizin des 21. Jahrhunderts in den Strukturen des mittleren 20. Jahrhunderts."
Übersetzt bedeutet das: Die Inhalte der jetzt beschlossenen Gesetze mögen den aktuellen Herausforderungen Rechnung tragen, es könnte aber sein, dass deren Effekte schnell verpuffen, weil die Grundlagen für eine strukturierte Versorgung fehlen.
Große Hoffnungen werden daher in die Versorgungsforschung gesetzt, die zu einem Teil aus dem Innovationsfonds gefördert werden soll - im Gesetz wird ausdrücklich von einer Verbesserung der Versorgung in der GKV und einer besonderen Nähe zur praktischen Patientenversorgung gesprochen. Das ist gut so.
So ließe sich eine gezielte Versorgungssteuerung bei begrenzten Ressourcen sicherstellen. Beispiel stationäre Versorgung: Eine detaillierte Analyse der Strukturen könnte zur Schließung von 500 kleineren spezialisierten Kliniken vorzugsweise in Ballungszentren führen - ohne Versorgungsengpässe zu riskieren, rechnet Professor Mansky vor, der in der TU Berlin das Fachgebiet Strukturentwicklung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen verantwortet. "Es ist kaum zu erwarten, dass die Politik dazu bereit wäre."
Wie nachhaltig sind die Reformen?
Zu einer Analyse sollte auch der gesamte Pflegebereich gehören. Möglicherweise sind die Betreuungsdefizite etwa in der Altenpflege größer als angenommen. Der Gesetzgeber dreht hier an vielen Stellschrauben, um die Versorgung alter Menschen zu verbessern.
Dafür wird eine Menge Geld in die Hand genommen. Und dennoch bleibt das Kernproblem ungelöst: Wie schafft man es, genügend Pflegerinnen und Pfleger für diesen Beruf zu begeistern? Eine Antwort darauf will die Koalition mit dem Entwurf eines Pflegeberufegesetzes geben. Die Kritik ist kaum zu überhören, weil ein solches Gesetz, eher davon abhält, den Beruf zu erlernen, heißt es - "zuviel Breite zu wenig Tiefe".
Ende 2015 kann es keine Antwort auf die Halbwertszeiten der vielen Gesundheitsgesetze geben. Die weltpolitischen Ereignisse in diesem Jahr und die hohe Zahl an Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, haben manche innen- und sozialpolitische Debatte in ihrer Bedeutung relativiert.
Darüber sollte die Koalition die großen Fragen, wie die Gesundheitsversorgung und die Pflege auf lange Sicht zukunftsfest gemacht werden kann, nicht aus den Augen verlieren. Noch hat sie dazu knapp zwei Jahre Zeit.