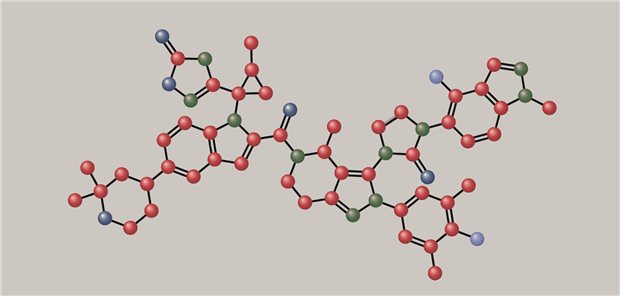Übergang Klinik und Hausarzt
Fehlerbericht gesucht
Heute startet die dritte große Themenaktion auf dem Online-Portal www.jeder-fehler-zaehlt.de. Gefragt sind Fehlerberichte zum Übergang zwischen Klinik und Hausarztpraxis.
Veröffentlicht:FRANKFURT/MAIN. Die Schnittstelle ambulant/stationär und vice versa zählt seit jeher zu den neuralgischen Punkten im medizinischen Versorgungsgeschehen. Hier gilt der Koordinationsbedarf als besonders hoch - und die tatsächliche Koordination als besonders insuffizient.
Nun nimmt sich des Themas auch das Institut für Allgemeinmedizin der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität an. Von Anfang April bis Ende Mai sammelt das Institut auf seiner Website jeder-fehler-zaehlt.de Fehlerberichte rund um die stationäre Aufnahme, das Entlassmanagement sowie die Medikationsumstellung im Wechsel zwischen Klinik und Hausarztpraxis. Die Aktion wird vom Aktionsbündnis Patientensicherheit und der Techniker Krankenkasse unterstützt.
Berichten kann jeder, eine Zugangsbeschränkung gibt es nicht, versichert Projektleiterin Tatjana Blazejewski. Auch eine persönliche Anmeldung sei nicht erforderlich, Teilnehmer könnten vollständig anonym bleiben.
Neben Hausärzten und MFA sind diesmal natürlich auch Krankenhausärzte und Pflegepersonal aufgefordert, von ihren Erfahrungen zu erzählen.
Vor der Veröffentlichung auf der Website würden die Berichte zunächst auf Datenschutz-Konformität hin geprüft. Sollten sich aus irgendwelchen Angaben Rückschlüsse auf konkrete Personen oder Situationen ziehen lassen, würden diese Angaben entfernt, erläutert Blazejewski.
"Es muss kein Patientenschaden entstanden sein"
Die Projektleiterin legt Wert darauf, dass die Beiträge nicht mit der schon sprichwörtlichen Schere im Kopf verfasst werden: "Es muss kein Patientenschaden entstanden sein, um ein Ereignis zu berichten. Kein kritisches Ereignis ist zu unwichtig oder zu schwerwiegend, um hier nicht gemeldet werden zu können."
Das ähnlich einem Web-Forum aufgebaute Fehlerberichts- und Lernsystem "jeder-fehler-zaehlt.de" wurde 2004 gestartet. Es ermöglicht auch, publizierte Berichte mit Kollegen zu diskutieren.
Zwei große Themen wurden bisher in Angriff genommen: Zunächst eine Sammlung kritischer Ereignisse in der Hausarztpraxis. 2011 folgte dann der Aufruf, über Friktionen an der Schnittstelle Hausarztpraxis/Apotheke zu berichten.
Bis heute sind laut Blazejewski über 600 Berichte und 2800 Kommentare eingegangen, die vom Institut analysiert und in diversen wissenschaftlichen Publikationen berücksichtigt wurden.
Auch aus der aktuellen Aktion sollen wieder Fallanalysen, Zusammenfassungen und Praxistipps resultieren, die Ärzten, Pflegern und MFA im Alltag weiterhelfen könnten. (cw)