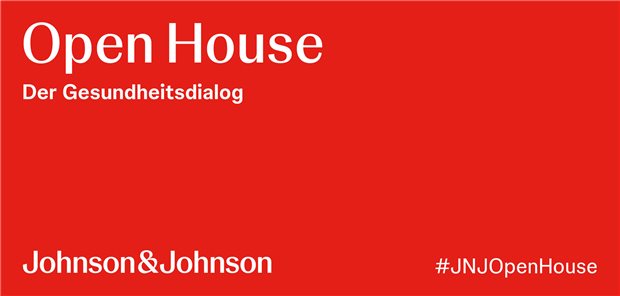Im Gespräch
Gesundheitsökonom Schreyögg: Notfallreform könnte pro Jahr fünf Milliarden Euro einsparen
Überfüllte Ambulanzen, gestresste Ärzte, hohe Kosten: Die Notfallversorgung gehört zügig reformiert, sagt der Hamburger Gesundheitsökonom Jonas Schreyögg. Auf den Gesetzentwurf der Ampel lasse sich aufbauen – mit einer Ausnahme.