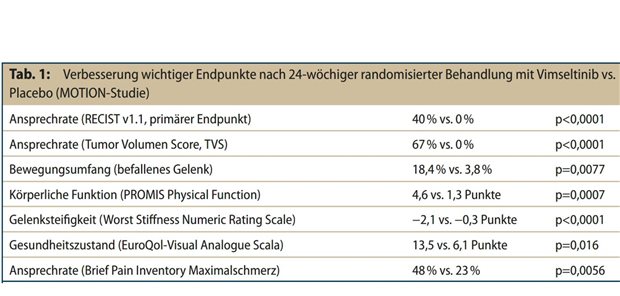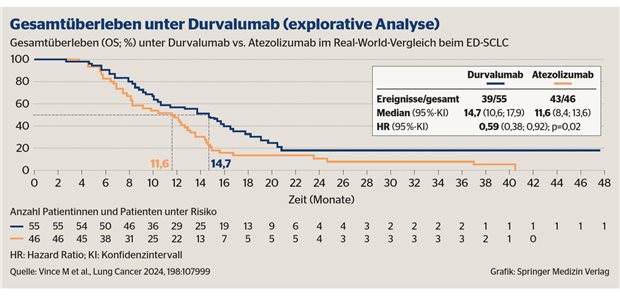Marburg
Strahlenzentrum sieht sich auf einem guten Weg
Das Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum soll Krebspatienten eine präzisere Behandlung und damit weniger Nebenwirkungen ermöglichen. Die Anlage, die seit ihrem Blitzstart nun stabil läuft, ist aber keine Wunderwaffe gegen Krebs.
Veröffentlicht:
Im Behandlungsraum: Professor Thomas Haberer demonstriert die Kopfmaske, die für jeden Patienten eigens gefertigt wird.
© Gesa Coordes
MARBURG. Der 17-Jährige mit dem Hirntumor an der Schädelbasis kann während seiner Krebstherapie sogar noch zur Schule gehen.
Der junge Mann gehört zu den ersten Patienten des Ionenstrahl-Therapiezentrums auf den Marburger Lahnbergen. Jeden Tag nach dem Unterricht geht er in das futuristisch anmutende Gebäude mit den knallgelben Wänden, das mit einem Architekturpreis ausgezeichnet wurde.
Die Bestrahlung auf der robotergesteuerten Patientenliege dauert nur wenige Minuten. Doch zuvor wurde die optimale Strahlendosis für jeden einzelnen Punkt des Tumors anhand einer dreidimensionalen Computersimulation und eines Wasserphantoms aufwändig errechnet und eine Kopfmaske gefertigt, die an der Liege festgeschraubt wird.
Der 17-Jährige darf sich keinen Zentimeter rühren, damit der Strahl den Tumor so exakt trifft, dass das umliegende Gewebe geschont wird. Und bei ihm gelingt die Therapie so gut, dass er überhaupt keine Nebenwirkungen verspürt.
Ionenstrahlen selten eingesetzt
Der 17-Jährige profitiert von Ionenstrahlen zur Behandlung von Krebs, die bislang sehr selten eingesetzt werden. Weltweit gibt es nur in Heidelberg, Italien und Japan vergleichbare Zentren, die sowohl mit Protonen als auch mit Schwerionen arbeiten.
In Marburg konnte die 120 Millionen Euro teure Einrichtung erst nach einer vierjährigen Hängepartie eröffnet werden - nach der mehrheitlichen Übernahme durch das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum. Zu den Heidelberger Gründern zählt der Pionier der modernen Strahlentherapie, Professor Thomas Haberer, der nun auch wissenschaftlich-technischer Leiter in Marburg ist.
Mit den ersten Monaten ist er zufrieden: "Die Anlage läuft sehr stabil", sagt der Experte. Auch die Mannschaft habe sich nach dem Blitzstart im vergangenen Jahr gut entwickelt.
Rund 50 Techniker, Ärzte, MTAs und andere Fachleute wurden zum Teil monatelang in Heidelberg geschult, wo eine ähnliche Anlage bereits seit sieben Jahren erfolgreich läuft. Dort geben sich die Patienten täglich zwölf Stunden lang die Klinke in die Hand.
Größter Unterschied: Neben horizontalen Strahlen gibt es dort - weltweit einzigartig - auch eine so genannte Gantry, eine rotierende Anlage, die den Tumor aus jedem beliebigen Winkel beschießen kann. Anstelle dieser Strahlenkanone hat Marburg einen Behandlungsplatz mit einem 45-Grad-Strahl.
Dazu gibt es drei Behandlungsräume mit horizontalen Strahlen. Für alle Plätze gibt es inzwischen auch Genehmigungen.
40 Krebskranke behandelt
Bislang profitierten mehr als 40, größtenteils aus der Region stammende Patienten von der Technik. Zunächst wurden ausschließlich Krebskranke mit seltenen Tumoren an Kopf und Hals behandelt. Prostatakrebs-Patienten sollen folgen.
Fast alle berichten, dass sie keine oder deutlich weniger Nebenwirkungen haben. Gemeinsam mit dem Heidelberger Zentrum werden auch mehr als 20 klinische Studien vorangetrieben, mit denen die Behandlungsformen verglichen werden.
Das Verfahren ist trotzdem keine Wunderwaffe gegen Krebs. Deshalb müssen die Mitarbeiter verzweifelten Kranken oft absagen, die sich in letzter Hoffnung an das Zentrum wenden. Die Methode eignet sich fast nie für Tumoren, die bereits Metastasen gebildet haben.
Hoffnung verspricht sie vor allem für klar abgegrenzte, schwer zugängliche Tumore am Kopf, an der Wirbelsäule, in Speicheldrüsen, Leber oder Prostata sowie bei bestimmten Krebsarten im Kindesalter.
Davon profitieren Krebspatienten, bei denen das Tumorwachstum mit der herkömmlichen Strahlentherapie nicht gestoppt werden kann.
Stromverbrauch von Großgemeinde
Die Behandlung, bei der Protonen und Kohlenstoffionen in einer Beschleunigeranlage auf mehr als 70 Prozent der Lichtgeschwindigkeit gebracht werden, ist drei- bis fünfmal teurer als die herkömmliche Krebsbehandlung. Schließlich hat das Zentrum den Stromverbrauch einer Großgemeinde.
Die Betriebskosten werden auf mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Die hohen Kosten, die einer begrenzten Zahl von Patienten gegenüberstehen, waren auch der Grund, warum Krankenhausbetreiber Rhön sich 2011 zurückziehen wollte.
In Kiel gab es eine baugleiche Anlage, die deshalb sogar wieder abgebaut wurde. "Das war ganz bitter", sagt Haberer.
Marburg ist dieses Schicksal erspart geblieben. Der Patientenbetrieb sei zunächst langsam angelaufen, berichtet Haberer. Einige Verhandlungen mit den Krankenkassen laufen auch noch.
In Zukunft soll die Zahl der Patienten auf 750 pro Jahr steigen. Dann soll sich das Zentrum auch wirtschaftlich tragen. Eine "Cash Cow" sei es jedoch nicht, sagt Haberer: "Das ist keine Methode, die große Gewinne verspricht."