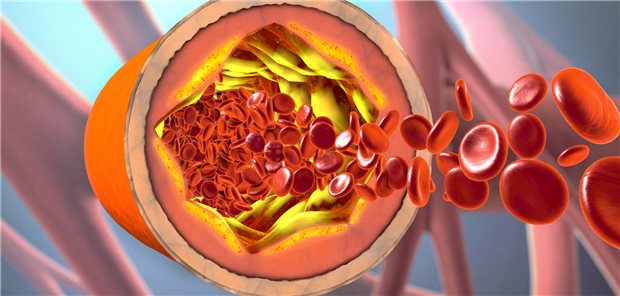Baustelle Weiterbildung
Wo soll das Geld herkommen?
Die ärztliche Weiterbildung ist ein Milliardenprojekt. Für die Finanzierung die Reserven anzuzapfen, sei keine Lösung, hieß es auf dem Internistentag. Doch wo soll das Geld dann herkommen?
Veröffentlicht:
Weiterbildung einer jungen Ärztin: Die Kosten dafür sind weder in den DRGs noch in den EBM eingepreist.
© INSADCO / imago
BERLIN. Rund eine Milliarde Euro im Jahr wird künftig für die Finanzierung der Weiterbildung benötigt. Darüber waren sich die Diskussionsteilnehmer auf einem berufspolitischen Podium auf dem Internistentag in Berlin einig. Die Frage, aus welchen Töpfen diese Summe finanziert werden soll, blieb allerdings offen.
Der Vorschlag des Hauptgeschäftsführers der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum, die Mittel aus dem gut gefüllten Gesundheitsfonds zu entnehmen, stieß auf Ablehnung.
"Die finanzielle Lage des Fonds ist kein Dauerzustand", erinnerte Dr. Franz-Josef Bartmann, im Vorstand der Bundesärztekammer zuständig für die Weiterbildungsordnung. "Es muss von denen kommen, die den Fonds füllen", erklärte der Kammerpräsident aus Schleswig-Holstein. Das sind die Beitragszahler und der Bundesfinanzminister.
"Rucksackmodell" für junge Ärzte
Allerdings darf seiner Ansicht nach das Geld für die Weiterbildung nicht in die Sachleistungen eingepreist werden, sondern soll als eigenständiger Beitrag klar erkennbar bleiben, sagte Bartmann.
Eine Finanzierung über die Einzahler in den Gesundheitsfonds würde die privaten Krankenversicherer nicht an den Kosten für die Weiterbildung beteiligen, sagte Branko Trebur von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).
Die KBV sehe die Finanzierung der Weiterbildung als gesellschaftliche Aufgabe. Sie favorisiere daher die "Rucksackmodelle": Dabei erhalte der Arzt in der Weiterbildung Geld, das er frei für die verschiedenen Stationen auf dem Weg zum Facharzt nutzen könne.
Dr. Andreas Botzlar, zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes, lehnte dagegen Extra-Gelder für die Weiterbildung ab. "Das Geld soll durch die gleichen Röhren fließen, wie bisher. Die Weiterbildung muss Frucht der ärztlichen Tätigkeit sein", sagte er.
Wenn es gesondertes Geld für die Weiterbildung gäbe, könnte der Gesetzgeber Versorgungssteuerung über den Bedarf an Weiterbildungsassistenten betreiben. Außerdem: "Junge Ärzte sind keine Stipendiaten, sie leisten ärztliche Arbeit."
Eine Diskussion, ob die Finanzierung der Weiterbildung aus den DRGs herausgetrennt werden sollen, will auch die DKG nicht führen. "Wir sollten zunächst darauf setzen, dass Add-ons auf die Fallpauschale gezahlt werden", so Hauptgeschäftsführer Baum.
Dabei sollten zusätzliche Zahlungen nur an jene Kliniken geleistet, die nachweislich eine qualitativ hochwertige Weiterbildung anbieten.
Debatte bis 2016 verlängert
Aber auch Inhalte der Weiterbildung bestimmten die Debatte auf dem Internistentag. Durch den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sei die Weiterbildungsordnung eine "Dauerbaustelle", erklärte Dr. Wolf von Römer, Vizepräsident des Berufsverbandes Deutscher Internisten (BDI).
Da immer mehr Lerninhalte nur noch in der ambulanten Versorgung gelehrt werden könnten, fordert der BDI die Einbindung der ambulanten Weiterbildungsinhalte in die Weiterbildungsordnung. Gleichzeitig solle "die fachliche Identität der Fachgebiete und ihrer Schwerpunkte" erhalten bleiben.
Die sieht von Römer in Gefahr, wenn die Vorstellungen der Bundesärztekammer von Flexibilisierung und Modularisierung der Weiterbildung so wie bisher vorliegend umgesetzt würden.
Die verschiedenen Module bildeten die Gebietsgrenzen nicht ausreichend ab, sagte von Römer. Dass den Diskussionen um die Weiterbildung nun weitere zwei Jahre eingeräumt werden sollen, stieß beim Internistentag auf Zustimmung.
Dies biete die Möglichkeit, Wege zu finden, Aus- und Weiterbildung zu verknüpfen, sagte KBV-Hausärztevorstand Regina Feldmann bei einer weiteren Veranstaltung. Dies werde politisch bislang nur halbherzig angegangen, weil den Ländern als Träger der Universitäten das Geld dafür fehle, sagte Feldmann.