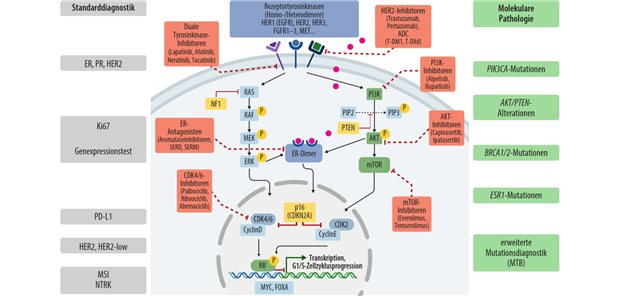Weniger Mykosen nach Immuntherapie
MÜNCHEN (kat). Bei etwa einem Drittel aller Patientinnen mit vaginalen Mykosen kommt es trotz erfolgreicher Therapie immer wieder zu Rezidiven. Grund dafür ist meist ein geschwächtes vaginales Abwehrsystem. Hilfe kann hier die Stimulation der lokalen Abwehr durch eine Immuntherapie bieten.
Veröffentlicht:Infektionen im Genitalbereich sind bei Frauen häufig. Meist sind Trichomonaden, Bakterien und Pilze die Auslöser. Ob es sich wirklich um eine Infektion und nicht um eine proinflammatorische Reaktion oder um eine Allergie handelt, ist aber oftmals gar nicht so leicht zu erkennen.
Darauf hat Professor Ernst Weissenbacher aus München bei einer Pressekonferenz zur 20. Internationalen Tagung über Infektionen in München hingewiesen. Hilfe bei der Differentialdiagnostik bietet nach neuen Studiendaten die Bestimmung der humoralen Scheiden-Interleukine.
Handelt es sich wirklich um eine Infektion, kann durch eine Immuntherapie die lokale Abwehr gestärkt werden. Erfolgreich hat sich diese Methode zum Beispiel in einer Pilotstudie mit 90 Patientinnen mit kulturell gesicherter chronisch-rezidivierender Vaginal-Candidose erwiesen.
Die Frauen wurden in der Vivantes-Frauenklinik am Urban in Berlin entweder mit einer Heliotherapie (sechs Wochen dreimal pro Woche Lichttherapie mit UV-B-haltigem sonnenähnlichem Spektrum in individuell ansteigender Dosis), einer antimykotischen Therapie (10 Tage Ciclopiroxolamin als Vaginalzäpfchen oder -creme) oder mit der Lactobacillus-Vakzine Gynatren® (3 x 1 Injektion i.m. alle 2 Wochen) behandelt.
Nach vorläufigen Ergebnissen konnte die Rezidivrate in allen Studiengruppen signifikant gesenkt werden - von durchschnittlich sieben Rezidiven pro Jahr auf 2,1, 1,8 beziehungsweise 1,4 Rezidive nach Heliotherapie, Antimykotika-Therapie oder Immuntherapie.
Der Bedarf an zusätzlichen Antimykotika sank, wobei dies bei immuntherapierten Frauen am ausgeprägtesten war. Die zuvor oft erniedrigten Interleukinspiegel stiegen unter der Immuntherapie an (IL 10, 16, nicht aber die proinflammatorischen Interleukine).
Wie Kontrolluntersuchungen nach zwei Wochen sowie nach drei und sechs Monaten ergaben, hatten sich Symptome wie Brennen, Fluor und Schmerzen bereits bis zur ersten Visite gemindert und reduzierten sich nach Anwendung der Suspension aus inaktiven spezifizierten Laktobazillen im Verlauf noch weiter. Dies führte dazu, daß nur unter Immuntherapie die Lebensqualität von Visite 1 bis 3 in allen Bereich kontinuierlich anstieg.