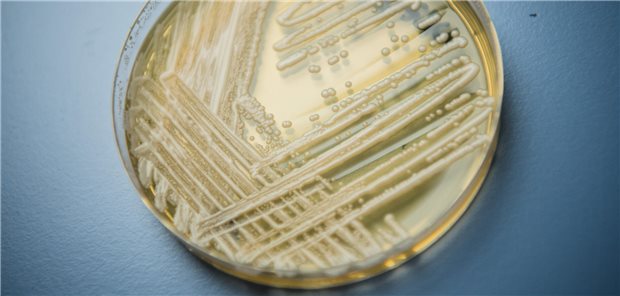Notfallversorgung
Nur jeder Zweite informiert sich vor dem Gang in die Notaufnahme
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst so attraktiv machen, dass der Gang in die Klinik keine Option mehr ist? Daran feilt die KV Hamburg. Eine noch nicht publizierte Studie aus dem Norden sorgt zudem für eine Versachlichung der Debatte.
Veröffentlicht:
Informationen aus Büchern oder Internet: bei vielen Fehlanzeige.
© scanrail, iStock / KBV / Montage: Ärzte Zeitung
Überfüllte Notaufnahmen: Das bedeutet Wartezeiten von mehreren Stunden, leidende Patienten, überarbeitete Ärzte. In der gesundheitspolitischen Arena überziehen sich die Verbände von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten gegenseitig mit Vorwürfen und entwickeln Szenarien, wie man den Andrang besser kanalisieren könnte.
Dass es auch anders geht, hat am Dienstag ein Symposium zum Thema im Institut für Allgemeinmedizin am Hamburger UKE gezeigt. Nachdem Hamburgs KV-Chef Dr. Walter Plassmann vorgetragen hatte, mit welchen Maßnahmen Patienten künftig vor dem Eintritt in die Notaufnahme geholfen werden könnte, gab es sogar Lob von der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft (HKG).
"Alles, was Ärzte für die Patienten besser zugänglich macht, kann uns nur helfen", sagte HKG-Geschäftsführerin Claudia Brase. Damit spielte sie auf das von Plassmann angekündigte Maßnahmenpaket an – die KV will ab 2018 das "ganz große Besteck" auftischen: Unter dem Markennamen "Arztruf Hamburg" wird es dann neben einem fahrenden Dienst und einer verbesserten Terminvermittlung auch Portalpraxen und eine ärztliche Soforthilfe per Telefon geben. Ziel: Patienten sollen das Angebot als attraktiver empfinden als den Weg in die Notaufnahme der Krankenhäuser.
Dass diesen immer mehr Menschen wählen, ist unstrittig. Die angebliche "Patientenexplosion" in den Notaufnahmen aber hat nach KV-Zahlen nie stattgefunden. Laut Plassmann beträgt die Zunahme jährlich rund zwei Prozent, während sie in den KV-Notfallpraxen bei acht Prozent liegt.
Kommt die KV dem Sicherstellungsauftrag nicht nach?
Der von Klinikseite geäußerte Vorwurf, die KVen kämen ihrem Sicherstellungsauftrag nicht nach, ist für Plassmann damit entkräftet. Das Symposium sorgte aber auch mit Zahlen aus einer noch nicht publizierten Studie ("PiNo", "Patientinnnen und Patienten in Notaufnahmen") für eine Versachlichung.
Das Institut für Allgemeinmedizin am UKE hatte im Auftrag der KVen Hamburg und Schleswig-Holstein sowie des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) 1299 Patienten in den Notaufnahmen von UKE, Marienkrankenhaus, Bethesda-Krankenhaus Bergedorf (alle Hamburg), Sana Klinikum Lübeck und Diako Flensburg befragt.
Mangelnde Information der Patienten
Die Ergebnisse zeigen, wie bequem, schlecht informiert und in Gesundheitsfragen inkompetent viele Patienten heute sind – deren Entscheidung für die Notaufnahme also nur folgerichtig ist.
Bevor sie diese ansteuern, haben sich nur 51,7 Prozent Auskünfte in irgendeiner Quelle – etwa medizinisches Fachpersonal, Internet oder Laien – über ihre aktuellen Beschwerden geholt. Rund die Hälfte trifft also die Entscheidung für die Notaufnahme ohne jede weitere Information.
Weitere Ergebnisse der Studie:
- Bestehende Alternativen sind vielen Menschen unbekannt: Zwar kennen 96 Prozent der Befragten auch den für lebensbedrohliche Lagen zuständigen Rettungsdienst (112), aber nur 31 Prozent wussten etwas mit dem in Hamburg etablierten fahrenden ärztlichen Dienst (116117) anzufangen. Die Notfall- oder Anlaufpraxen in ihrer Nähe kannten auch nur 42 Prozent.
- Beschwerden sind oft schon älter: Nur rund 54 Prozent hatten die Beschwerden, die Ursache für das Aufsuchen der Notaufnahmen waren, noch keine 24 Stunden, weitere 15 Prozent noch keine drei Tage. Rund 30 Prozent der Patienten kommen also mit Beschwerden in die Notaufnahme, die sie länger als drei Tage plagen – eine Zeitspanne, in der ein Termin in einer Arztpraxis möglich gewesen wäre.
- Dringlichkeit ist nicht geboten: Nach eigener Einschätzung besteht bei 45 Prozent der Befragten eine hohe Dringlichkeit. 55 Prozent verneinten dies. 29 Prozent kamen auf Anraten Dritter, 26 Prozent gaben mangelnde hausärztliche Verfügbarkeit, 21 Prozent mangelnde fachärztliche Verfügbarkeit an.
Patienten mit niedriger Behandlungsbedürftigkeit waren im Durchschnitt jünger und seltener im Ausland geboren, nannten häufiger die Nichtverfügbarkeit einer Hausarztpraxis als Grund und klagten seltener über zunehmende oder starke Beschwerden.
Subjektiv empfundene Behandlungsdringlichkeit
Bei ihnen waren häufiger Traumata am Bewegungsapparat und Affektionen der Haut Auslöser für den Weg in die Notaufnahme. Die subjektiv empfundene Behandlungsdringlichkeit war höher bei Patienten mit einem höheren Maß an Ängstlichkeit oder Depressivität und bei einer geringeren Fähigkeit der Patienten, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und umzusetzen.
Für Professor Martin Scherer, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin, zeigen die Ergebnisse in eine klare Richtung: "Es besteht die Erwartung, dass ich rund um die Uhr einen Arzt verfügbar habe." Für ihn ist deshalb eine erste Schlussfolgerung aus der Studie, dass an der Gesundheitskompetenz gearbeitet werden muss.
Bis das Früchte trägt, helfen Informationen und Angebote, die die Kliniken entlasten. Es gelte aber auch, die Grenzen der Notaufnahmen aufzuzeigen und deren Zweck zu verdeutlichen. "Wir müssen zeigen, wofür das System gemacht ist."
Lesen Sie dazu auch: Notfalldienst: Praxen und Kliniken streiten um Patienten