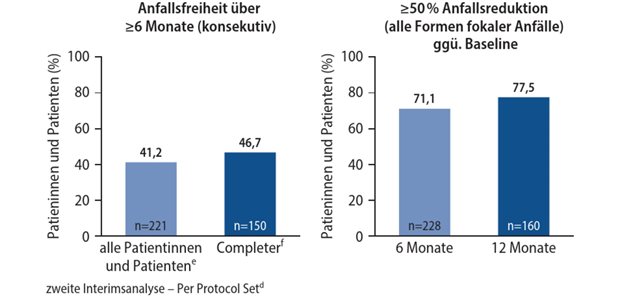Adhärenz bei Anti-CD20-Therapie hoch
Eine Therapie mit Anti-CD20-Antikörpern kommt bei den Patienten offenbar gut an: Die Abbruchraten sind nach schwedischen Registerdaten deutlich geringer als mit vielen übrigen MS-Wirkstoffen.
Veröffentlicht:Stockholm. Eine B-Zell-depletierende Therapie mit Antikörpern, die sich gegen CD20 richten, war vor der Zulassung von Ocrelizumab nur off-label mit Rituximab möglich. Ist eine solche Off-label-Behandlung in Deutschland problematisch, erfreut sie sich in Skandinavien großer Beliebtheit – sowohl bei MS-Experten als auch bei Patienten. Darauf deuten schwedische Registerdaten, die das Team um Dr. Mathias Granqvist vom Karolinska-Institut veröffentlicht hat (JAMA Neurol 2018, online 8. Januar).
Abbruchrate von drei Prozent
Die Forscher analysierten Angaben zu sämtlichen MS-Kranken, die zwischen 2012 und 2015 in den Regionen Stockholm und Västerbotten erstmals auf eine krankheitsmodifizierende Behandlung eingestellt worden waren. Primär interessierten sie sich dabei für die Abbruchraten. Diese sind bei injizierbaren MS-Mitteln recht hoch. Die Wissenschaftler um Granqvist zitieren Studien, nach denen weniger als die Hälfte der Patienten eine Therapie über zwei Jahre mit injizierbaren Präparaten durchhält. Die Forscher wollten herausfinden, wie gut sich im Vergleich dazu Rituximab schlägt. Das Ergebnis ist überraschend: Mit dem off-label verabreichten Antikörper waren die Abbruchraten mit Abstand am geringsten.
Die Forscher fanden Angaben zu knapp 500 erstmals eingestellten Patienten mit schubförmiger MS. Fast die Hälfte (44 %) erhielt initial Interferone oder Glatirameracetat, 17 Prozent bekamen Dimethylfumarat (DMF), zehn Prozent Natalizumab, drei Prozent Fingolimod und immerhin knapp ein Viertel (24 %) Rituximab. Patienten mit Rituximab hatten im Schnitt etwas stärkere Behinderungen als solche mit injizierbaren Mitteln, aber einen ähnlichen EDSS-Wert wie MS-Kranke unter Fingolimod und DMF. Patienten mit Natalizumab waren im Schnitt etwas jünger und hatten vor der Therapie mehr Schübe als diejenigen unter Rituximab. Die schwedischen Ärzte sahen Rituximab folglich vor allem für Patienten vor, die einen mittelschweren Verlauf zeigten.
Die Abbruchraten – egal ob durch mangelnde Wirksamkeit, Nebenwirkungen oder Schwangerschaft bedingt – unterschieden sich recht deutlich. Nach einem Jahr hatte rund ein Drittel der Patienten mit injizierbaren MS-Mitteln die Behandlung abgebrochen, nach zwei Jahren waren es sogar zwei Drittel. Von den Patienten mit Natalizumab und DMF hielten drei Viertel das erste Jahr durch, immerhin etwa die Hälfte zwei Jahre. Für Fingolimod deutete sich eine ähnliche Kurve wie für die injizierbaren Mittel an, aufgrund der geringen Patientenzahlen ist diese jedoch kaum aussagekräftig. Dagegen hatten von den 120 Patienten mit Rituximab nur fünf die Therapie in den ersten beiden Jahren beendet. Insgesamt betrug die jährliche Abbruchrate unter injizierbaren Mitteln 53 Prozent , unter DMF 32 Prozent, bei Fingolimod 38 Prozent und Natalizumab 29 Prozent, unter Rituximab jedoch nur 3 Prozent.
Abbruch wegen Schwangerschaft
Vier der Rituximab-Patientinnen beendeten die Therapie aufgrund einer Schwangerschaft, ein Patient aufgrund erneuter Krankheitsaktivität. Dagegen standen bei den übrigen Therapien Nebenwirkungen und eine unzureichende Wirkung als Gründe für den Abbruch im Vordergrund; die Natalizumab-Therapie wurde bei einem Drittel der Patienten aufgrund eines positiven JCV-Tests beendet.
Unter Berücksichtigung der Krankheitsschwere und anderer Faktoren gab es keine signifikanten Unterschiede bei der Schubrate zwischen einer Therapie mit Rituximab, DMF, Fingolimod und Natalizumab. Kontrastverstärkende MRT-Läsionen traten unter Rituximab jedoch signifikant seltener auf als unter DMF und injizierbaren Mitteln. Bei den Nebenwirkungen gab es kaum Differenzen, leichtere Beschwerden traten unter DMF und injizierbaren Mitteln etwas häufiger auf.
Da es sich um eine Registeranalyse mit recht geringer Patientenzahl und kurzer Beobachtungsdauer handelt, ist Vorsicht geboten. Rituximab hat als MS-Therapeutikum in Deutschland zudem keine Chance – Erstattungsfragen wären hier im Gegensatz zu Schweden bei einer Off-label-Therapie ein großes Problem. Sollten jedoch neue vollhumanisierten Anti-CD20-Antikörper wie Ocrelizumab und Ofatumumab ein ähnlich gutes Nutzen-Risiko-Profil aufweisen wie Rituximab, könnten diese für viele Patienten eine Bereicherung darstellen.