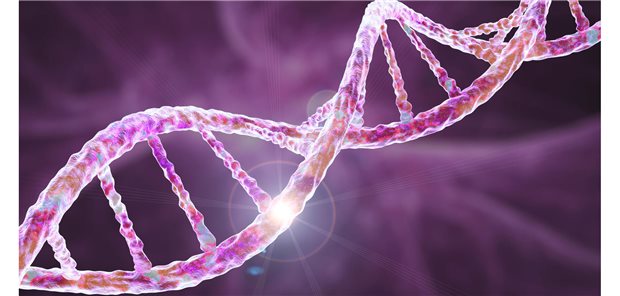Egal ob Fisch oder Patient
PET und fMRT bei Depressiven kaum zu gebrauchen
PET und fMRT taugen offenbar wenig, um herauszufinden, was im Gehirn depressiver Menschen passiert. Solche Studien liefern meist inkonsistente und nicht reproduzierbare Resultate - fast wie einst bei einer Studie mit einem toten Lachs.
Veröffentlicht:
Forscher haben die Ergebnisse von Hirnaktivitätsstudien bei Depressiven analysiert.
© digitalefotografien / fotolia.com
JÜLICH. Vor vier Jahren sorgte der Ig-Nobelpreis des US-Forschers Craig Bennett für Furore: Er legte einen frischen toten Lachs ins MRT, primär um das Gerät zu kalibrieren. Dem toten Lachs stellte er dieselben Fragen wie später den Testpersonen – er sollte den emotionalen Zustand von Personen auf Fotos erkennen.
Tatsächlich flammte bei einigen Fragen im Gehirn eine Aktivität auf, sofern die Forscher nicht multiple Korrekturen vornahmen. Da solche Korrekturen bis dahin nicht immer üblich waren, besteht die Gefahr, dass nicht wenige der Hirnaktivitätsstudien schlicht auf technischen Artefakten beruhen.
Auch bei Depressiven wurden viele solcher Studien aufgelegt. So lassen sich bei diesen Patienten Defizite in der Verarbeitung emotionaler und kognitiver Reize messen. Die Wissenschaft würde natürlich gerne wissen, welche Hirnregionen davon besonders betroffen sind und veränderte Aktivitätsmuster zeigen.
Vielleicht hilft dies, die Defizite zu erklären und besser zu verstehen. Allerdings setzt das voraus, dass die Ergebnisse der Hirnaktivitätsmessungen reproduzierbar sind und ähnliche Studien zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen.
Das ist jedoch bisher nicht der Fall: Mehrere Metaanalysen führten zu sehr heterogenen Ergebnissen, wobei nicht klar ist, ob dies an der Methodik der Metaanalysen oder der berücksichtigten Studien liegt.
99 Experimente analysiert
Ein Team um Dr. Veronika Müller vom Forschungszentrum in Jülich hat daher 57 Studien mit zusammen über 1000 Patienten zu diesem Thema gründlich unter die Lupe genommen (JAMA Psychiatry 2016, online 9. November). Alle wurden zwischen 1997 und 2015 aufgelegt, die meisten also noch vor dem Ig-Nobelpreis für die Tote-Lachs-Arbeit.
Die Forscher bestimmten dabei die Hirnaktivität bei 34 Tests zur kognitiven und bei 65 zur emotionalen Informationsverarbeitung. In den Studien sollten die Patienten unter anderem, ähnlich wie Bennetts Fisch, positive und negative emotionale Zustände von Gesichtern erkennen oder Gedächtnisaufgaben lösen.
Berücksichtigt für die Analyse hat das Team um Müller nur Studien mit unipolarer Depression als Hauptdiagnose der beteiligten Patienten. Ferner wurden nur Untersuchungen mit Gruppenvergleichen eingeschlossen. Eine weitere Bedingung waren Ganzhirnaufnahmen und nicht nur Untersuchungen in bestimmten Hirnbereichen.
Insgesamt rechneten die Forscher für die jeweiligen Experimente 16 unterschiedliche Analysen durch, für jede dieser Subanalysen veranschlagten sie mindestens 17 Experimente. Dabei berücksichtigen sie jeweils, ob die Patienten Medikamente gegen ihre Depression bekamen oder nicht, auch Patienten mit Komorbiditäten und geriatrischen Depressionen wurden gesondert betrachtet.
Spektrum inkonsistenter Resultate
Insgesamt resultierten 50 Experimente in einer überwiegend erhöhten und 49 in einer erniedrigten Hirnaktivität. Irgendein gemeinsamer Nenner ließ sich jedoch auch in den 16 Subanalysen nicht finden.
Sollten die Patienten etwa negative Emotionen erkennen, dann zeigten die einzelnen Studien keine signifikanten Gemeinsamkeiten bei Zahl und Lokalisation von Hirnregionen mit erhöhter und erniedrigter Aktivität. Wurde nach Patienten mit oder ohne Medikation, Komorbiditäten und geriatrischer Depression unterschieden, ergaben sich ebenfalls keine kongruenten Ergebnisse.
Nur wenn die Daten statistisch korrekt bearbeitet wurden, um den Toten-Lachs-Effekt zu vermeiden, zeigte sich eine gewisse Übereinstimmung der Aktivitätsmuster im linken Thalamus und Hippocampus. Eine solche Korrektur fehlte aber bei rund 40 Prozent der Experimente.
Die Forscher sehen vor allem methodische Mängel der einzelnen Studien als Ursache für die heterogenen Ergebnisse. Auch könnten Design und Abläufe der einzelnen Experimente die Ergebnisse deutlich beeinflusst haben.
"Die derzeitige Literatur zur Bildgebung bei unipolarer Depression ist so heterogen, dass sich keine allgemeingültigen Effekte zeigen lassen", schlussfolgert das Team um Müller. Das Problem ließe sich nur lösen, wenn es genügend gleichartige Experimente gäbe. Das sei in der Regel aber nicht der Fall, da es Arbeitsgruppen schwer hätten, ähnlich designte Arbeiten zu veröffentlichen.
"Forscher werden dafür belohnt, innovative Prozeduren zu entwickeln, die sich von früheren Arbeiten unterscheiden. Das führt zu einem breiten Spektrum isolierter Resultate, denen jegliche Konsistenz fehlt und die sich nicht verallgemeinern lassen", schreiben die Forscher.
Sie fordern daher, bei der funktionellen Bildgebung auch einen Schwerpunkt auf die Replikation von Studien zu legen. Dazu müssten die Studienautoren die Charakteristika ihrer Patienten genau erfassen sowie die Mess- und Korrekturmethodik besser offenlegen.