Europäischer Erfinderpreis
Schichtbilder in Sekundenschnelle haben Chancen auf Preis
FLASH-Technik: Für seine bahnbrechende Innovation auf dem Gebiet der Magnetresonanztomographie ist der Physiker Professor Jens Frahm für den Europäischen Erfinderpreis nominiert worden.
Veröffentlicht: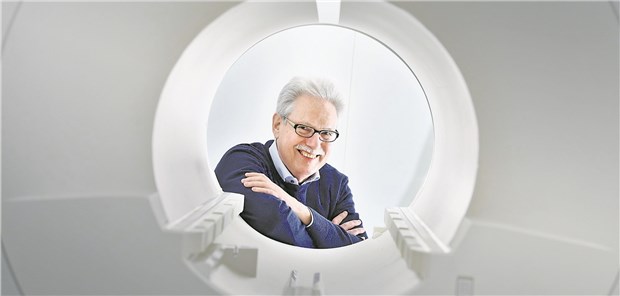
Dass MRT-Untersuchungen heute schnell vonstattengehen, ist Professor Jens Frahm und seinem Team zu verdanken.
© Frank Vinken / Max-Planck-Gesellschaft
GÖTTINGEN. Hohe Auszeichnung für den Göttinger Physiker Professor Jens Frahm: Das Europäische Patentamt (EPA) hat den 67-jährigen Wissenschaftler vom Max-PlanckInstitut für biophysikalische Chemie für den Europäischen Erfinderpreis 2018 nominiert. Frahm ist einer von drei Finalisten in dem Bereich Forschung.
Mit dem Erfinderpreis werden einzelne Erfinder und Teams ausgezeichnet, die mit ihren Entwicklungen dazu beitragen, technische Antworten auf die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Das Europäische Patentamt würdigt damit Frahms Innovationen auf dem Gebiet der Magnetresonanztomographie.
Mit der von ihm entwickelten Technik habe er das diagnostische Potenzial der Magnetresonanztomographie erschlossen und Millionen von Patienten geholfen, sagte EPA-Präsident Benoit Battistelli bei der Bekanntgabe der Nominierung.
MRT revolutioniert
Der gebürtige Oldenburger Jens Frahm revolutionierte mit seiner Technologie die 1973 von dem späteren Nobelpreisträger Professor Paul Lauterbur erfundene Magnetresonanztomographie (MRT). Das bildgebende Verfahren macht sich bekanntlich die magnetischen Eigenschaften der Wasserstoffatome zunutze, die sich im Gewebe und in den Körperflüssigkeiten befinden. Mithilfe der chemischen Information der MRT-Signale lassen sich genaue Einblicke in Gewebe, Muskeln, Organe und Stoffwechselvorgänge gewinnen.
Das damals neue Verfahren hatte zunächst den Nachteil, dass es für den Einsatz in der Medizin schlicht zu langsam war. Dies änderte sich erst durch die FLASH-Technik, die Jens Frahm in den frühen 1980er-Jahren mit seinem Team in Göttingen entwickelte.
Höchste räumliche Auflösung
Diese Innovation, mit der sich die Messzeiten radikal verkürzten, brachte den Durchbruch für die breite Anwendung der Kernspintomographie in der medizinischen Diagnostik. Hatte die erste MRT-Aufnahme eines Menschen noch vier Stunden und 45 Minuten gedauert, ließen sich mit FLASH nun bereits innerhalb weniger Sekunden einzelne Schichtbilder herstellen.
Erstmals wurden auch dreidimensionale Aufnahmen mit höchster räumlicher Auflösung in Messzeiten von wenigen Minuten möglich. Heute ist die FLASH-MRT eines der bedeutendsten bildgebenden Verfahren in der Medizin, das weltweit jährlich bei 100 Millionen Untersuchungen zum Einsatz kommt.
FLASH ist das bislang erfolgreichste Patent der Max-Planck-Gesellschaft. Mit den bisher erzielten rund 155 Millionen Euro Lizenzeinnahmen wurde unter anderem die gesamte Forschung der 1993 gegründeten gemeinnützigen Biomedizinischen NMR Forschungs GmbH in Göttingen finanziert.
Weltweite Vorreiterrolle
Inzwischen haben die Göttinger Wissenschaftler ihre Technik weiterentwickelt und damit wieder eine weltweite Vorreiterrolle übernommen: Mit der "FLASH2"-Technologie kann man erstmals live verfolgen, was im Körper passiert.
Mediziner können damit zum Beispiel Gelenk- oder Sprechbewegungen, Schluckvorgänge oder das schlagende Herz direkt beobachten und daraus Rückschlüsse darauf ziehen, warum das Knie beim Beugen schmerzt, jemand unter Sodbrennen leidet, stottert oder Schmerzen im Brustbereich hat. Die neue Technologie wird bereits an einigen Universitätskliniken für den routinemäßigen Einsatz an Patienten getestet, unter anderem in Göttingen, Frankfurt, Düsseldorf, Oxford und Baltimore.
Die Echtzeit-MRT eröffne unter anderem ganz neue Möglichkeiten für die Diagnostik und Behandlung von Herzpatienten, sagt Frahm. So können beispielsweise Herzrhythmusstörungen sehr viel genauer analysiert werden. Der bereits vielfach ausgezeichnete Physiker freut sich über die Nominierung: "Das ist eine besondere Anerkennung."
Ähnlich wie bei der Oscar-Verleihung wird auch der Gewinner des Europäischen Erfinderpreises erst bei der Preisverleihung bekannt gegeben. Der Festakt findet am 7. Juni in Saint-Germain-en-Laye bei Paris statt. Schon die Nominierung ist eine hohe Auszeichnung, wie das Beispiel Stefan Hell zeigt: Der Göttinger Physiker war 2006 in der Kategorie "Lebenswerk" nominiert. Hell gewann dann zwar am Ende nicht den Erfinderpreis, dafür aber 2014 den Nobelpreis.






