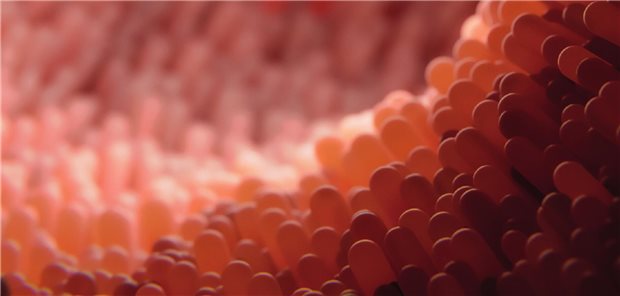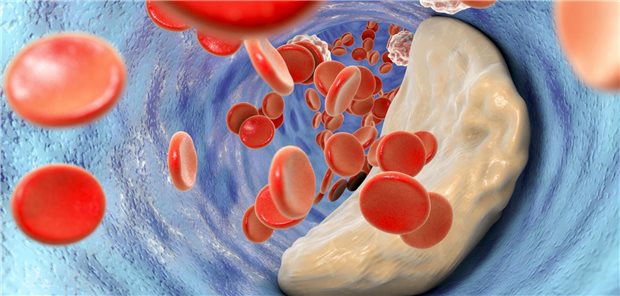Ernährung
Was Wurmeier in uraltem Kot verraten
Vor 700 Jahren aßen die Menschen in Lübeck zunehmend Rindfleisch und weniger Fisch. Das haben Forscher anhand Latrinen aus dem Mittelalter gefunden. Doch warum?
Veröffentlicht:
Mittelalterliche Toiletten verraten Forschern viel über die Ernährung damals Lebender.
© T. Linack / stock.adobe.com
OXFORD. Menschen in der Hansestadt Lübeck haben um das Jahr 1300 herum vermutlich ihre Ernährung umgestellt: Statt hauptsächlich Süßwasserfische aßen sie vermehrt Rindfleisch. Dies folgern Wissenschaftler aus der Untersuchung von Bandwurm-Eiern, die sie in den Überbleibseln mittelalterlicher Latrinen gefunden haben.
Die Forscher stellen ihre Studie im Fachmagazin "Proceedings B" der britischen Royal Society vor. Ob der zunehmende Reichtum oder die zunehmende Verschmutzung der Gewässer dafür verantwortlich ist, können die Wissenschaftler nicht beantworten.
Grundsätzlich ist die genetische Untersuchung von altem Kot nicht neu. Bisher sei sie aber hauptsächlich auf Einzelproben angewendet worden und um die Erreger von Krankheiten, wie Pest, Lepra, Pocken, Malaria und Tuberkulose, zu finden, schreiben die Forscher um Adrian Smith von der University of Oxford (Großbritannien).
Das Team um Smith untersuchte Kotproben aus Lübeck und Ellwangen, Bristol und York (Großbritannien), Zürich (Schweiz) und Breclav-Pohansko (Tschechien). Die Proben stammten überwiegend aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Über eine Genanalyse bestimmten sie die Arten der Eier verschiedener parasitischer Würmer.
In Proben aus Lübeck fanden sie in großer Zahl Eier des Fischbandwurms (Diphyllobothrium latum) und des Rinderbandwurms (Taenia saginata). Allerdings war der Fischbandwurm vor dem Jahr 1300 sehr viel stärker verbreitet als danach; beim Rinderbandwurm war es genau umgekehrt. Dies deuten die Forscher als Hinweis auf eine Ernährungsumstellung .
Dass früher viel rohes oder wenig gekochtes Fleisch gegessen wurde, hatte auch ein Team um Martin S¢e von der Universität Kopenhagen in einer Studie herausgefunden, die im April veröffentlicht wurde. (dpa)