OECD-Bericht
Diskussion über Wartezeiten ist eine "Phantomdebatte"
Im internationalen Vergleich sind die Wartezeiten auf einen Arzttermin in Deutschland kurz, stellt die OECD fest. Und auch sonst steht das Gesundheitssystem ziemlich gut da. Es gibt allerdings auch Kritikpunkte.
Veröffentlicht: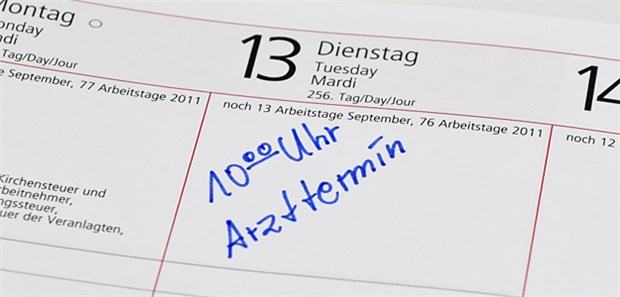
Im OECD-Vergleich schneidet Deutschland bei der medizinischen Versorgung, Wartezeiten und Notfallversorgung gut ab. Es gibt aber auch Kritik.
© Marco2811 / fotolia.com
BERLIN. Über Personalmangel muss das Gesundheitssystem in Deutschland nicht klagen. Jedenfalls, wenn man die internationale Perspektive einnimmt.
4,1 Ärzte, 13 medizinische Fachangestellte und Pflegekräfte standen 2013 laut einem aktuellen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für die Versorgung von je 1000 Einwohnern in Deutschland zur Verfügung. Das liegt deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 3,3 Ärzten und 9,1 Helfern.
Auf diesem Befund darf sich Deutschland nicht ausruhen. Deutsche Ärzte sind vergleichsweise alt. Zigtausende werden in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen. 42 Prozent der Ärzte in den Praxen und auf den Krankenhausstationen sind 55 Jahre alt und älter.
Nur in Belgien, Estland, Frankreich, Italien und Israel liegt der Anteil von Ärzten an der Schwelle zum Ruhestand noch höher. In Großbritannien dagegen haben erst 13 Prozent der Ärzte das Alter von 55 Jahren erreicht.
1400 syrische Ärzte
Knapp 32.000 ausländische Ärzte arbeiten derzeit in Deutschland, mehr als die Hälfte von ihnen kommt aus der Europäischen Union, bereits 1400 aus Syrien. Die Zahl der ausländischen Ärzte ist seit dem Jahr 2000 um mehr als 20.000 gestiegen. Dennoch hinkt Deutschland dem OECD-Durchschnitt hinterher.
Während in Deutschland 8,8 Prozent der praktizierenden Ärzte aus dem Ausland stammen, haben im OECD-Durchschnitt doppelt so viele eine Ausbildung außerhalb ihres Heimatlandes genossen. Der Zugang zur ärztlichen Versorgung gilt in Deutschland ausweislich des Berichts als gut.
Sorge bereitet der OECD die primärärztliche Versorgung. Die Zahl der hier tätigen Ärzte nimmt in zahlreichen entwickelten Ländern auf breiter Front ab, auch bei uns. Seit 1995 sinke die Zahl der Hausärzte in Deutschland, sagte der stellvertretenden Generalsekretär der OECD, Stefan Kapferer, bei einer Vorabpressekonferenz in Berlin.
Lag ihr Anteil damals noch bei mehr als der Hälfte, beträgt er im Berichtsjahr 2013 nur noch 42 Prozent.
"Eine Phantomdebatte"
Die Wartezeitendebatte in Deutschland wirkt aus der Vogelperspektive der 34 OECD-Mitgliedsstaaten eher unbedeutend. "Im internationalen Vergleich führt Deutschland eine Phantomdebatte über die Wartezeiten", sagte Kapferer.
Lob für Deutschland gibt es von der OECD auch: So erhalten die hohen Überlebensraten nach einer Schlaganfallversorgung als Indikatoren für den Ausbau des Gesundheitssystems sehr gute Noten.
Hüftoperationen bleiben Thema
Die Organisation will jedoch auch Hinweise auf Überversorgung ausgemacht haben. So gebe es eine "sehr hohe Anzahl von Krankenhäusern und Krankenhaus-Betten", heißt es in der OECD-Analyse. Im internationalen Vergleich sinke die Zahl der Betten nur langsam. Vor allem für die Behandlung von COPD und Diabetes sieht die OECD eine hohe Zahl von vermeidbaren Einweisungen ins Krankenhaus.
Auch die Operationen werden wieder thematisiert. Der Vorgängerbericht 2009 hatte Deutschland eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Hüft- und Knie-TEPS bescheinigt und damit viel Staub aufgewirbelt.
Auch der aktuelle Bericht sieht Deutschland an zweiter Stelle bei den Hüftendoprothesen. 283 Hüftgelenke je 100.000 Einwohner wurden im Berichtsjahr ausgetauscht. Nur die Schweiz hatte einen knapp höheren Wert. Im OECD-Durchschnitt waren es 161 Hüftoperationen.
Viel Geld für Arzneien
Deutschland liegt bei den Arzneimittelausgaben deutlich über dem Durchschnitt der Industrieländer. Nur die USA, Kanada, Japan und Griechenland geben pro Kopf der Bevölkerung mehr aus als die für Deutschland für das Jahr 2013 ermittelten 678 US-Dollar aus.
Damit hat Deutschland im Berichtsjahr 30 Prozent mehr für Arzneimittel ausgegeben als der Durchschnitt der berücksichtigten 29 OECD-Länder. Laut dem Bericht Befinden sich die Ausgaben auch 2014 weiter im Steigflug.
Als Ursache hat die OECD den vergleichsweise hohen Verbrauch an Antidiabetika und Blutdruck senkenden Mitteln ausgemacht. Auch der Wegfall der Zwangsrabatte und das Auftreten extrem teurer Medikamente zur Behandlung von Hepatitis C spiele eine Rolle.
Einen überproportionalen Anstieg verzeichnet die OECD beim Verbrauch von Antidepressiva. Hier landet Deutschland zwar mit 53 Tagesdosen je 1000 Einwohner noch knapp unter dem Durchschnitt der OECD-Länder, im Jahr 2000 habe dieser Wert jedoch erst bei 21 Tagesdosen gelegen.










