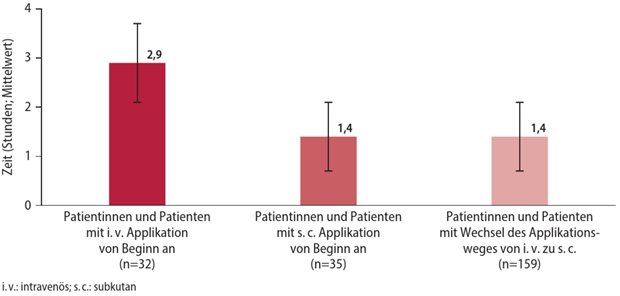Intensivbetten in der Pandemie
Fördergelder einfach eingestrichen? Krankenhäuser reagieren empört auf Vorwurf
Um den Einsatz von Fördergeldern zum Ausbau der Intensivkapazitäten in der Corona-Pandemie ist ein Disput entbrannt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern zweifelt an der Bettenstatistik. Die Krankenhausseite reagiert vergrätzt.
Veröffentlicht:
Eine Gruppe von Gesundheitsfachleuten hat Zweifel daran geäußert, dass Krankenhäuser alle Fördergelder in neue Intensivbetten investiert haben. Die Klinikseite reagiert empört.
© Helmut Fohringer / APA / picture alliance
Berlin. Vertreter der Intensivmediziner, des Marburger Bundes und der Krankenhäuser haben empört auf Aussagen aus einer Gruppe von Gesundheitsfachleuten reagiert, die Krankenhausseite habe Fördergelder für nicht existente Intensivbetten eingestrichen. „Diese Behauptung ist nicht haltbar“, heißt es in einer am Montagnachmittag verbreiteten Pressemitteilung.
In den ersten Monaten der Pandemie hatte die Bundesregierung den Aufbau von rund 11 .000 zusätzlichen Intensivbetten mit 530 Millionen Euro gefördert. „Nach unseren Recherchen scheinen diese Betten nicht existent zu sein“, hatte der ehemalige Gesundheitsweise Professor Matthias Schrappe am Sonntag der Tageszeitung „Die Welt“ gesagt. Dieser Vorwurf sei nicht belegt und deshalb zurückzuweisen, hatte ein Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn darauf am Vormittag reagiert.
Wissenschaftler stellen Fragen
Quelle des Ärgers ist ein am Sonntag verschicktes Thesenpapier einer Gruppe von Fachleuten, zu denen außer Schrappe eine Reihe renommierter Gesundheits-, Pflege-, Rechts- und Sozialwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen gehören, darunter auch der Chef des BKK-Dachverbands Franz Knieps.
Das Thesenpapier wirft Fragen nach der Angemessenheit der Reaktionen auf die Pandemie-Entwicklungen im vergangenen Jahr auf. Die Wissenschaftler zweifeln in ihrer Arbeit an der These, dass die Pandemie den massiven Ausbau von Intensivkapazitäten gerechtfertigt habe. Wenn er denn überhaupt stattgefunden habe.
Deutschland behandelt „intensiv“
„In keinem Land werden so viele hospitalisierte auf Intensivstationen behandelt (wie in Deutschland)“, heißt es in dem Papier, das der „Ärzte Zeitung“ vorliegt. Am 27. April dieses Jahres seien 61 Prozent der hospitalisierten COVID-Patienten auf Intensivstationen behandelt worden. An diesem Tag habe dies aber nur für 25 Prozent der COVID-Patienten in der Schweiz und elf Prozent der COVID-Patienten in Italien zugetroffen. Es stehe „Fehlversorgung“ im Raum.
Für die Vertreter der Krankenhausseite zielt dieser Vorwurf an der Realität vorbei. „Dies ist gerade die Stärke der deutschen Krankenhausstrukturen, schwerkranke Patienten adäquat intensivmedizinisch zu versorgen“, heißt es in der Reaktion der Verbände. Wer daraus Fehlversorgung konstruiere, müsste Daten vorlegen, dass die Behandlungsergebnisse in anderen Ländern gleich gut oder besser ausgefallen sind. Als „Schlag ins Gesicht der Ärztinnen und Ärzte und der Pflegekräfte“ werde der Vorwurf empfunden, dass Patienten ohne Not auf Intensivstationen verlegt worden sein könnten.
„Rückwirkende Korrektur“
Die Gruppe um Schrappe interpretiert Daten des DIVI-Intensivregisters zudem als „rückwirkende Korrektur“ der Intensivkapazitäten. Die Zahl der Intensivbetten nehme seit August vergangenen Jahres wieder ab, obwohl angesichts der „Triage-Diskussionen“ eher Anstrengungen zum Ausbau der Kapazitäten zu erwarten gewesen wären. Gleichzeitig habe sich die Zahl der belegten Intensivbetten nicht verändert.
DIVI, MB und DKG führen als Gründe für den Rückgang der Bettenzahl eine Änderung bei der Abfrage und die Personaluntergrenzen an. Angegeben werden könnten seither nur die betreibbaren Betten, für die es funktionsfähige Geräte, Material und eine ausreichende personelle Besetzung mit medizinischem und pflegerischen Personal gebe. Zudem würden seither die Reservekapazitäten getrennt abgefragt. Die Daten legten nahe, dass ein Teil der vorher gemeldeten freien Bettenkapazitäten nun als Notfallreserve angegeben würden. Diese Reserve werde aktiviert, in dem Maße, in dem andere Behandlungen abgesagt oder verschoben würden.